Dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht sehr viele Möglichkeiten, sich zu zerstreuen. Jeweils zwei Fernseh- und Radioprogramme, viel Gegend und damit jenseits von allem, was einen jugendlichen Geist speisen könnte, haben mich kreativ werden lassen. Vor allem dahingehend, was ich mit meiner Zeit anfange.
Lesen war eines dieser Dinge, und weil ich ein reichlich dünnes, blutarmes Kind war, habe ich Bücher gefressen. Nicht, dass es zur Zunahme meines Körperumfanges beigetragen oder mein Blutbild verbessert hätte. Aber mein Geist konnte sich dadurch ziemlich gut wegbeamen von den Bergen, die auf meinen Horizont drückten. Denn wer blutarm und schmächtig ist, hat normalerweise keinen Drang zu Gipfeln. Vielleicht via Lift, aber die führten halt nur zu ausgewählten Zwei- bis Dreitausendern. Im Winter schien das noch legitim, im Sommer verschmähten echte Bergfexe diese Option. Was mir schon früh klarmachte: Ich bin kein Bergfex. Dabei bleibe ich bis heute. Aber das ist eine andere Geschichte.
Den Zug zur Natur hatte ich damals auch noch nicht, denn es ist dem Menschen ja meist systemimmanent, dass er das Naheliegende nicht zu schätzen weiß. Dazu braucht es oft ein Kontrastprogramm, wie etwa 30.000 Autos, die täglich am Wohnzimmerfenster vorbeigasen, oder Nachbarn, die nachts nichts Besseres zu tun haben, als einen per Telefon zu tyrannisieren. Erst dann kann man Kuhgebimmel, die Kirchenglocke um 7 (!) Uhr früh und den Fladengeruch lieben lernen. Von Autos und Nachbarn der genannten Provenienz war ich damals weit entfernt. Insofern empfand ich mein Leben – sorry, Mutter! - als laaaaaaaaaangweilig. Heute bin ich natürlich dankbar für die Klavier- und Ballettstunden, die mir meine Eltern angedeihen ließen. Vor allem aber für die Deutsch-Nachhilfe.
Nicht, dass ich sie dringend benötigt hätte. Meine diesbezüglichen Noten waren einwandfrei. Und wenn ich versuche, mich zu erinnern, warum ich zum Deutschlehrer der hiesigen Hauptschule expediert wurde, finde ich nur einen Grund, nämlich dass meine Eltern etwas Vorhandenes weiter fördern wollten. Deshalb lesen Sie jetzt das, was Sie lesen. Und das trotz der diversen Katastrophen, die ich mit meinen Deutschlehrern erleben durfte. Die weniger am Inhalt als vielmehr an Formalitäten gehangen sind, die mir streckenweise meine angeleitete Kreativität arg verschüttet haben. Auch heute gibt es noch Lehrer dieser Art, doch ich weiß auch, dass das Bewusstsein steigt. Und dass Lehrer natürlich ihren Lehrplan haben, in dem steht, was die Schüler zu können haben. Aber fünf Jahre Erörterungen schreiben? Irgendwann hat es selbst der verträumteste Schüler begriffen. Sie merken schon - ich beginne mich zu echauffieren, also weg davon.

Was ich als Schreibpädagogin mehr als oft höre, ist: „Ich kann nicht schreiben.“ Grundsätzlich glaube ich das niemandem, denn wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann darauf, dass Menschen einen Stift halten und Buchstaben formen können. Doch was damit gemeint ist, ist, dass diesen Menschen der Glaube verloren gegangen ist, dass ihre geschriebenen Worte von irgendeiner Bedeutung sein könnten. Das ist die wirkliche Tragik dahinter. Interessanterweise gilt das für das gesprochene Wort nicht, sonst hätte unsere Medienwelt nicht den Begriff des ‚Unterschichtenfernsehens‘hervorgebracht. Gesagt wird alles, und wenn es noch dazu aus der Flimmerkiste kommt, MUSS es Bedeutung haben. Doch sobald die Minenspitze das Papier erreicht, ist das Selbstvertrauen im Mausloch verschwunden. Offen gesagt: Das verstehe ich nicht.
Grundsätzlich ist das Schreiben eine persönliche, wenn nicht intime Angelegenheit. Nur man selbst, der Stift und das Papier. Okay, vielleicht auch der Laptop – da scheiden sich die (Schreib-)Geister. Doch schon oft verweigern sich Menschen genau das. Und warum? Wegen des Zensors in ihrem Kopf. Meiner heißt übrigens Ethel. Wir beide haben eine mehr als intime Beziehung. Und trotzdem schreibe ich, wie Sie merken. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich Ethel inzwischen immer öfter auf ein rotes Samtkissen bette, auf das sie sich kuscheln kann und einschläft. Zum anderen habe ich nicht zuletzt durch Sie begriffen, dass jeder Mensch etwas zu schreiben hat, was für andere von Bedeutung sein kann. Und das hängt damit zusammen, dass Schreiben zum Reflektieren einlädt. Gesagt ist ja schnell etwas, und manch einer kann gar nicht so schnell denken, wie er spricht. Beim Schreiben umschifft man diese Falle. Denn wenn man selbst liest, was man verfasst hat, merkt man meist rasch, woher der innere Wind weht. Und ab dem Zeitpunkt, wo man zu relativieren beginnt, setzt auch die Wertschöpfung für andere ein.
In diesem Sinne möchte ich heute ausdrücklich ermutigen: SCHREIBEN SIE! Für sich, für Ihre Lieben, für die Öffentlichkeit. Teilen Sie es in Schreibgruppen oder -werkstätten mit anderen, denn nur so erweitert sich Ihr Horizont, Ihre Innen- und Außensicht. Es gibt nichts Falsches daran, man kann auch nichts falsch machen. Und möglicherweise erleben auch Sie dann diesen einen Moment, auf den ich heute noch stolz bin. Mein kreativ-kannibalistischer Deutschlehrer pflegte immer mit einer bestimmten Tageszeitung in die Klasse zu kommen. Seit fast 20 Jahren schreibe ich für diese Tageszeitung. Das heilt ungemein.

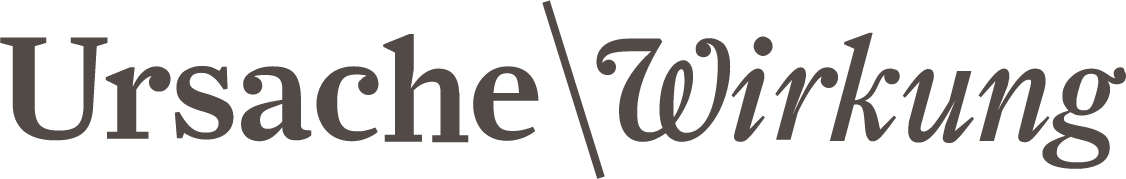
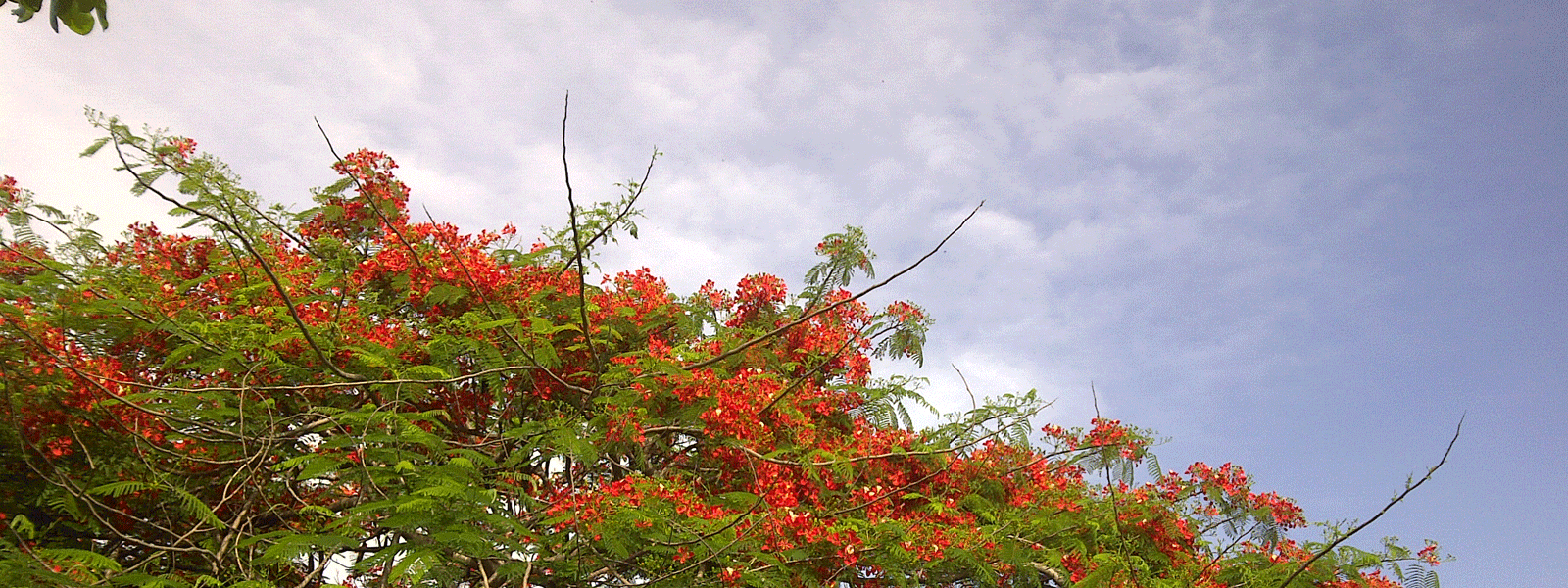




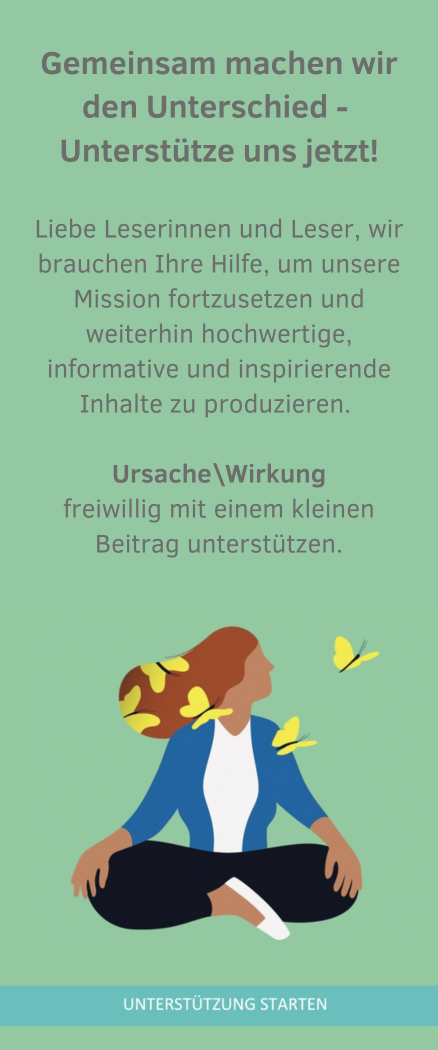
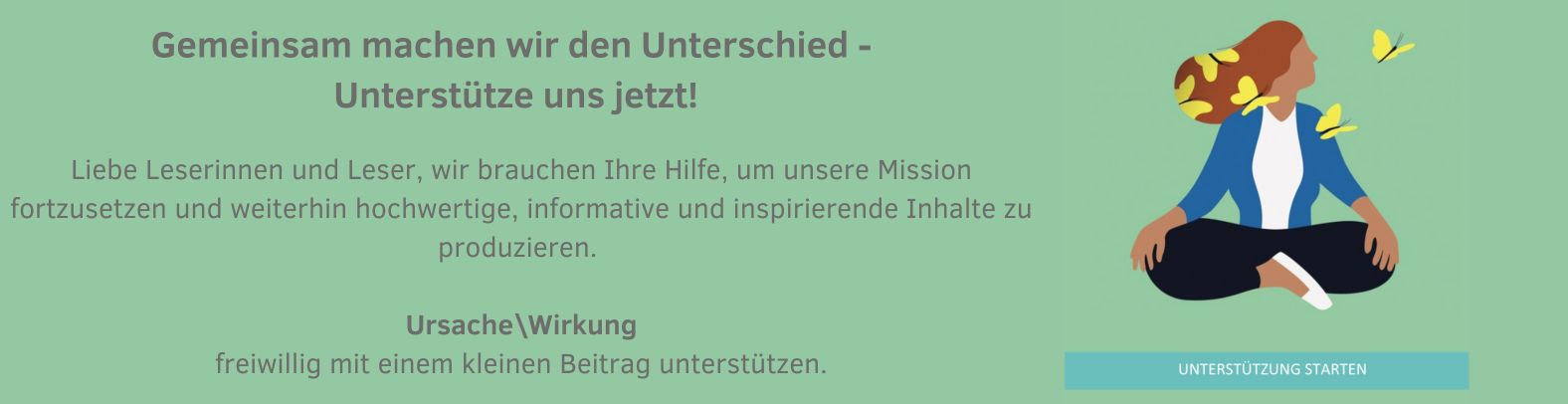

Dann gibt es immer einen Weg...