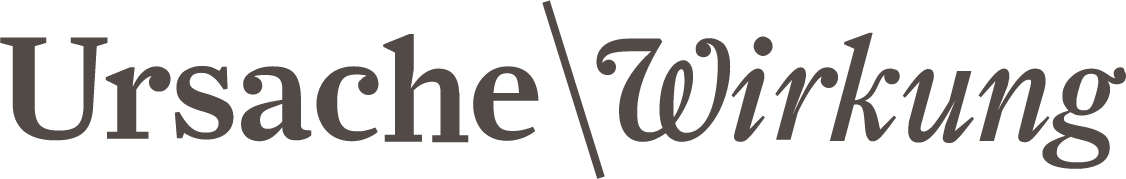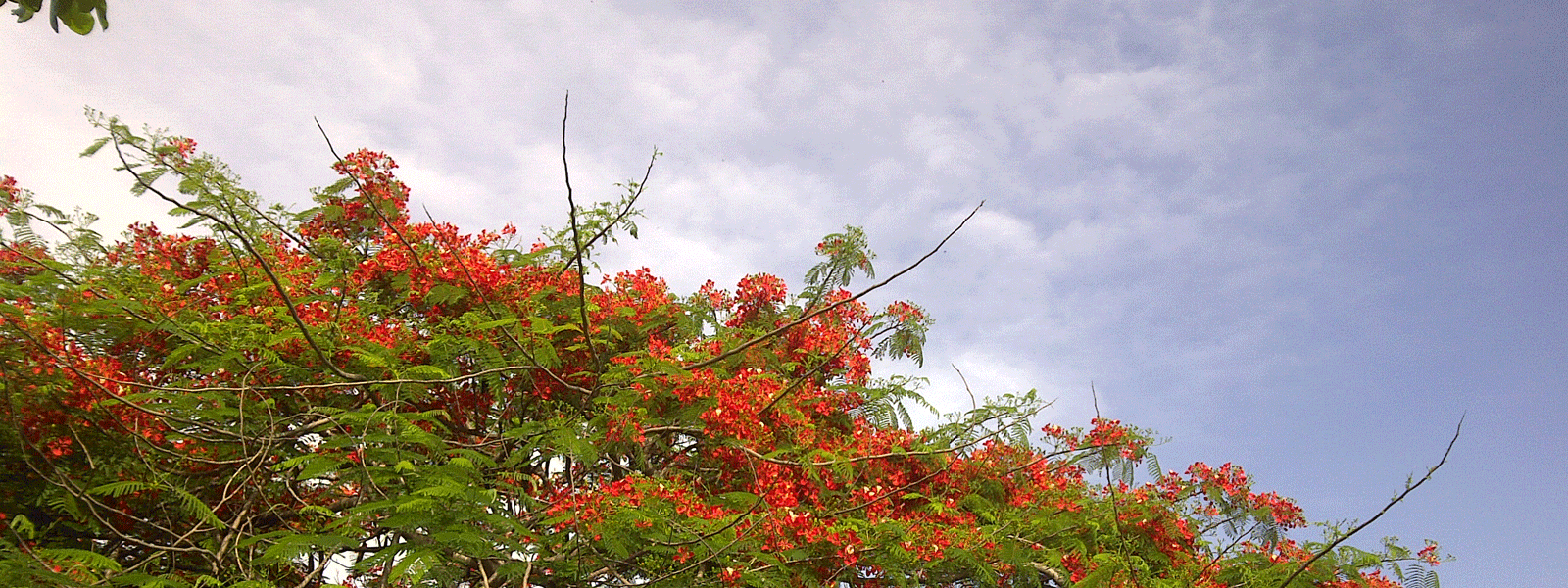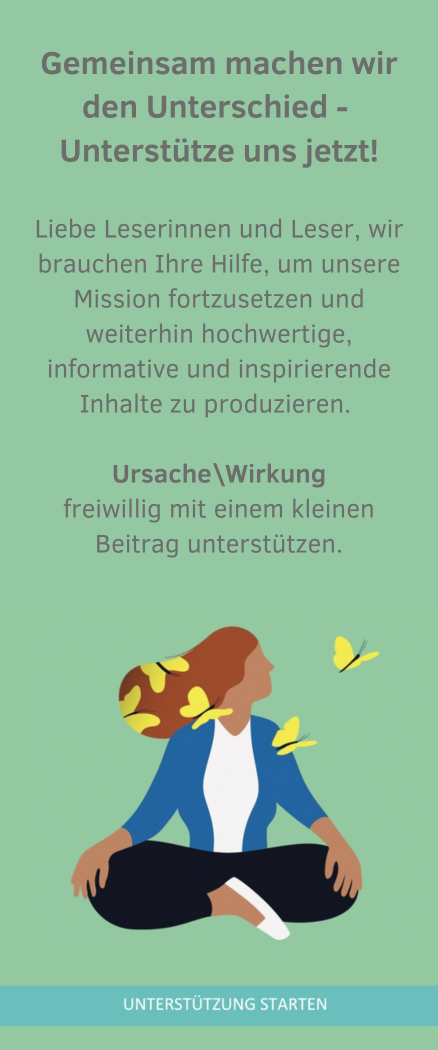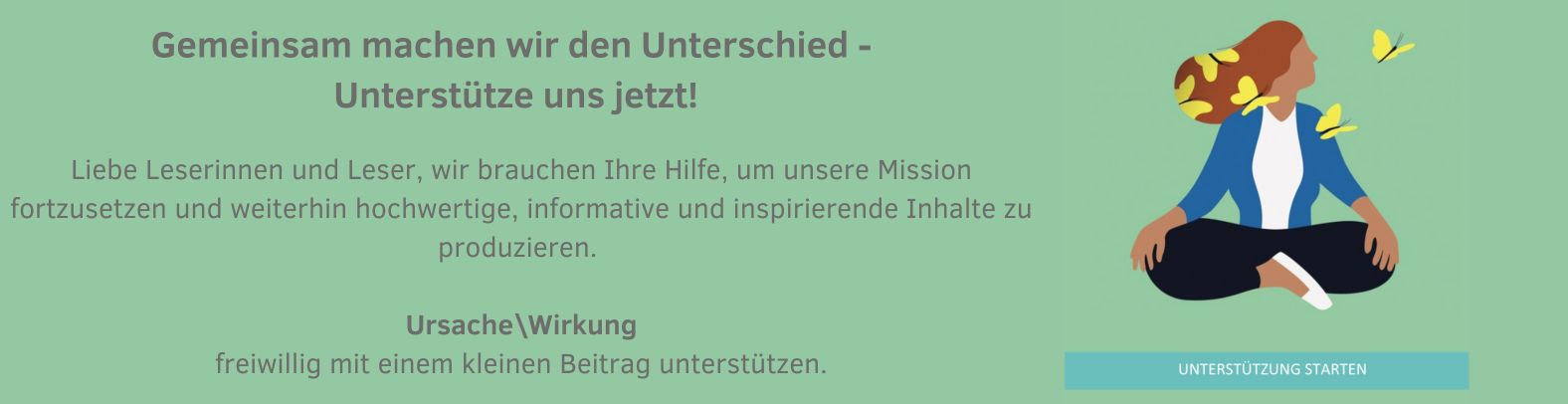Jetzt ist es mir schon wieder passiert. Hoffentlich entwickelt sich daraus kein Muster, dass ich im Zwei-Jahrestakt als „alternativ“ bezeichnet werde. Nicht dass daran etwas falsch wäre. Doch Sie kennen ihn bestimmt, diesen Augenblick, wenn Selbstbild auf Fremdbild prallt.
Das erste Mal, dass mich jemand als „alternativ“ bezeichnet hat, fand vor zwei Jahren statt. Ich hatte einen Mann kennengelernt, mit dem ich mich ganz gut verstand und den ich halbwegs hübsch fand. Er meldete sich zu ziemlich unorthodoxen Zeiten sprich knapp vor Mitternacht und lud mich beispielsweise zu einem Spaziergang durch den Park ein. Wo dann NIX passierte. Nachdem ich der ganzen Bekanntschaft relativ ergebnisoffen gegenüber stand, nahm ich die Dinge, wie sie NICHT passierten. Doch einige Monate später fragte ich ihn, ob ihm nie in den Sinne gekommen wäre, mit mir anzubandeln. Er bejahte das, fügte allerdings hinzu, dass er sich aus zwei Gründen dagegen entschieden hätte. Punkt Eins: mein Rauchen. Punkt Zwei: dass ich alternativ wäre.
Was ich damals als eine Einzeleinschätzung abtat, hat sich nun wiederholt. Nicht von einem Mann, sondern von einer jungen Frau, die ich wiederum als „alternativ“ eingeschätzt hätte. Und während einer Übungszeit in dem Workshop, den ich gehalten habe, bin ich in mich gegangen und habe meine eigene Definition gesucht. Dreadlocks oder einseitige Frisuren müssen sein, Gesundheitsschuhe sowieso und heutzutage gehört natürlich Veganismus dazu. In meiner „Alternativ“-Schublade liegt auch ein Berg von jenen Patchwork-Jacken, die man in Eine-Welt-Läden und auf Straßenmärkten sieht. Und natürlich die Harems-, wahlweise Pluderhosen, von denen ich auch eine ganze Menge im Schrank habe. Und von denen meine Mutter immer sagt, ich solle mich doch für Rock ODER Hose entscheiden.
Wäre an diesem Tag der Schritt meiner Hose zwischen den Knien gelegen, hätte ich die Beurteilung absolut verstehen können. Denn hierzulande tragen wirklich nur „bestimmte“ Leute solche Rockhosen. Dort, wo ich vorrangig meinen Urlaub verbringe, gehört das zum Alltag. Und weil ich gerne das Gefühl habe, jeden Tag ein bisschen im Urlaub zu sein, ist diese Kleidung eben in meine Garderobe integriert – egal, wo ich gerade bin. Also nicht bei einem Workshop für eine Bank oder sonstigen hochoffiziellen Angelegenheiten, natürlich. Doch sonst immer.
Also habe ich eine kleine Umfrage gestartet und gehört, was an mir als „alternativ“ empfunden werden könnte. Meine Haare zum Beispiel, die ich nach wie vor standhaft gegen natürliche und künstliche Farben verteidige. Dann die Zusammenstellung meiner Kleidung. Meine Kusine meinte an meinem 50. Geburtstag, dass mein Stil nur zu mir passt und keiner diesen für nachahmenswert halte. Fand ich gut, schließlich sollte jeder selbst für sich entdecken, was zu ihm gehört. Obwohl ich natürlich sehr für Farben bin und Schwarz nicht wirklich als dominierenden Ton in meinem Kleiderschrank zulasse. Das Leben ist bunt, und dem sollte man Rechnung tragen. Finde ich halt. Aber das ist auch nur meine Meinung, die nur für mich gilt.
Und dann kam noch die Rede auf meinen Schmuck. Aktuell trage ich drei Fußkettchen und zehn, meist kugelige Armbänder. Alle sind Erinnerungen geschuldet, auch ein bisschen dem ganz normalen Aberglauben. Und doch gehören sie zu mir wie Aufenthalte in Istanbul, Ägypten und Marrakesch, meine Kinder, mein kleiner Nachbar und mein Ex. Was ich an meinen Gelenken trage, ist praktisch mein Leben. Und wahrscheinlich werde ich deshalb sogar für „alternativ“ gehalten, wenn ich einen dunkelblauen Business-Anzug tragen. Ja, den besitze ich. Und ja, den trage ich auch. Doch wenn es unter dem Hosenumschlag klimpert und sich die Ärmel der Schluppenbluse nicht schließen lassen, weil zu eng, dann ist die Chance wohl relativ gering, als nicht-alternativ wahrgenommen zu werden.
Der Duden bietet für „alternativ“ die Definition „im Gegensatz zum Herkömmlichen stehend“ an. Das kann ich durchaus für mein Leben unterschreiben. Und deshalb werde ich mich wohl mit meinem Alternativ-Sein anfreunden müssen. Das dürfte alternativlos sein.