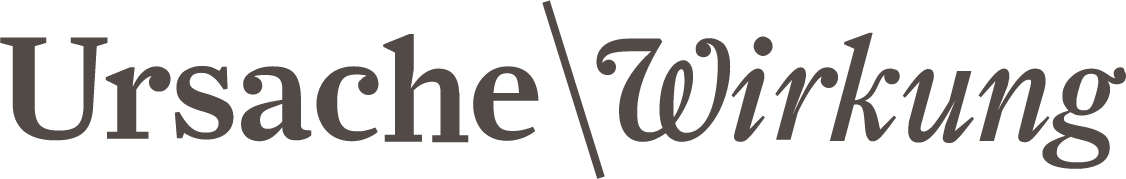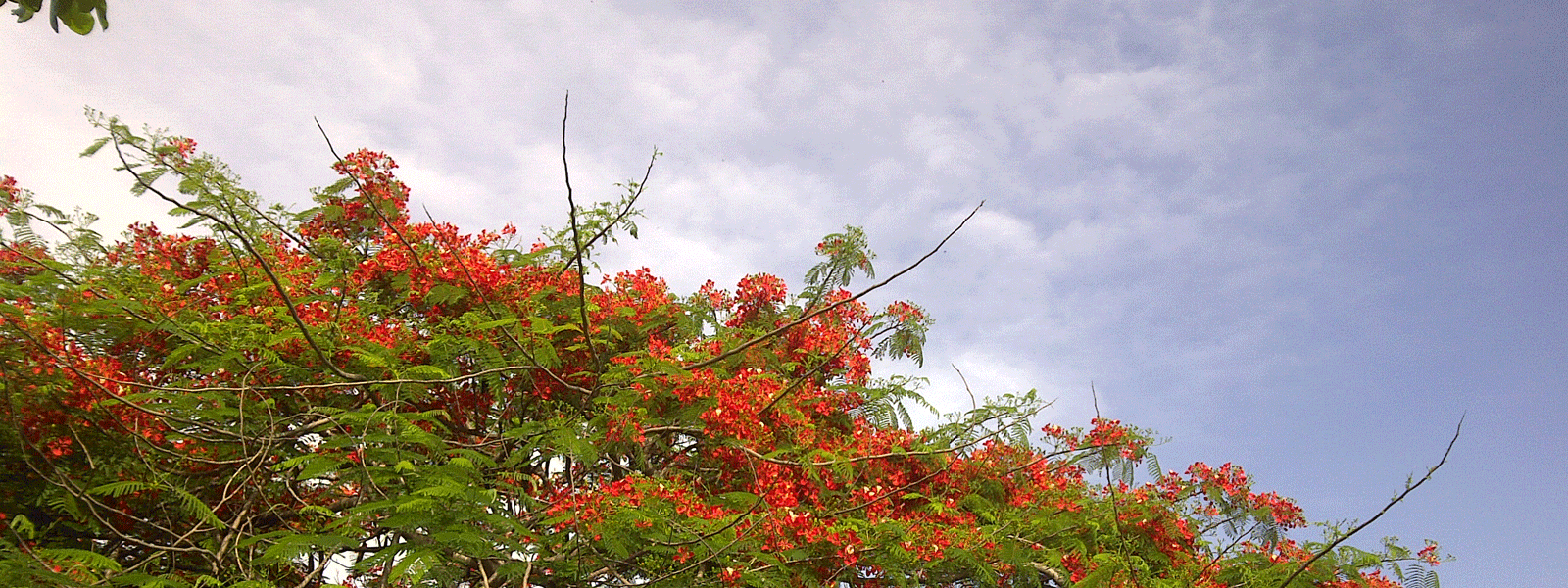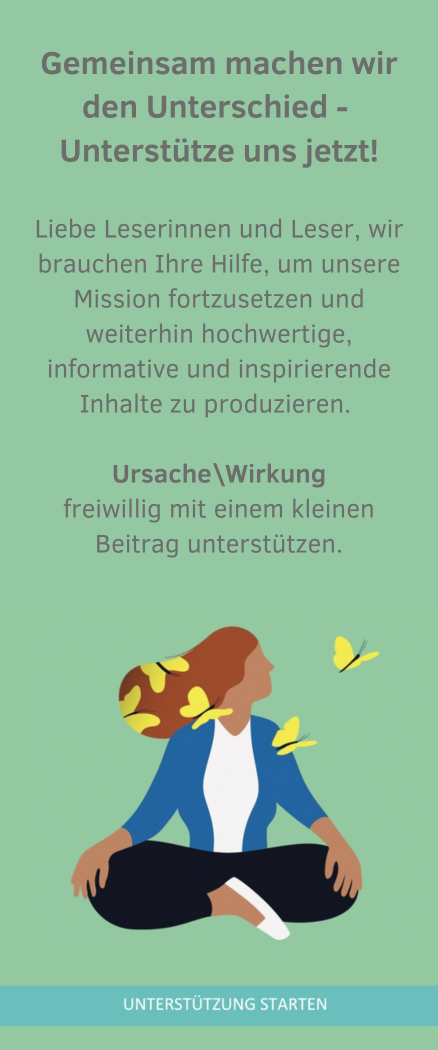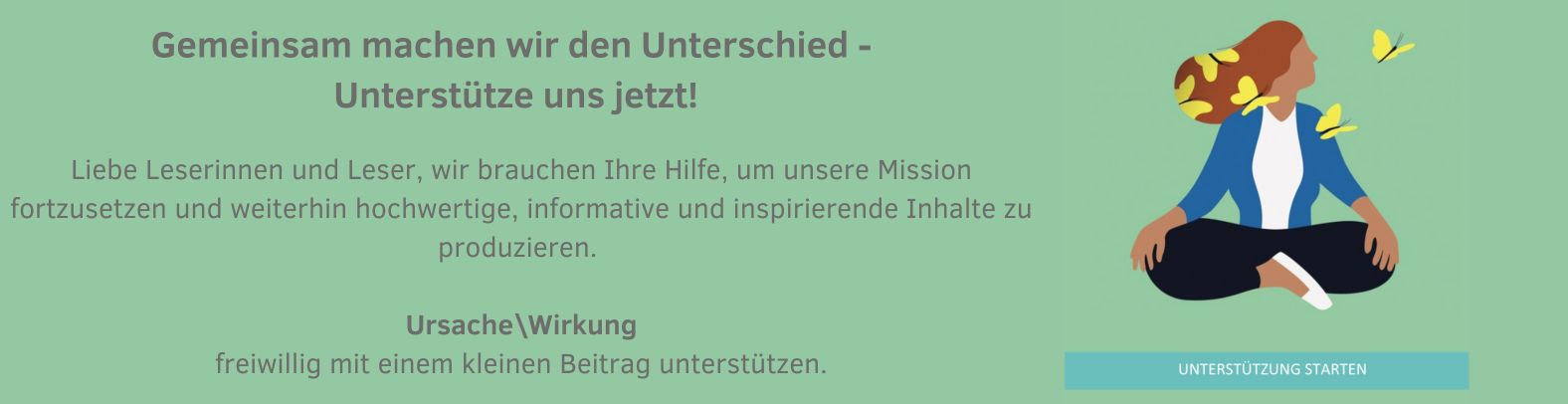„Ich war damals wirklich neidisch, weil Du so einen coolen Freund hattest“, sagt eine Freundin und meint einen Mann, der mit so vielen Talenten gesegnet war und so wenig daraus gemacht hat. Jetzt ist er gestorben.
Vor ein paar Jahren ist einer meiner Jugendfreunde gestorben – von ihm habe ich bis zum heutigen Tag den Fimmel, dass alles an mir irgendwie zusammenpassen muss. Er sah aus wie der junge Paul Newman, und ich weiß immer noch nicht, wieso er sich ausgerechnet mich ausgesucht hatte – damals. Ich war verschreckt, wohlbehütet und wahrscheinlich deshalb ersteres. Doch irgendwas sah er in mir, und wenn es vielleicht nur mein damaliger, verbesserungsbedürftiger Kleidungsstil war. Nein, über meinen jetzigen will ich NICHT diskutieren.
Ihm hatte ich damals meine Unschuld schenken wollen, doch irgendwie kam es nicht dazu. Ist mir übrigens insgesamt mit drei jungen Männern passiert, aber das ist eine andere Geschichte. Wie auch immer: Er war damals schon krank, zucker-krank. Und daran dürfte er auch gestorben sein. Auf jeden Fall fand man ihn bewusstlos und nicht mehr rückführbar. Wie meinen „coolen“ Freund. Die Sanitäter konnten ihn wohl kurzfristig „zurückholen“, doch heute morgen haben seine Organe versagt. Wenn ich das Foto anschaue, auf dem ein gemeinsamer Freund unsere Zweisamkeit ergänzt, sehe ich einen Mann, der so viel aus seinem Leben hätte machen können. Er war gutaussehend (siehe meine Freundin), groß gewachsen, sprachenbegabt und mit absoluter sozialer Kompetenz ausgestattet. Er hatte Geschmack, war witzig und er liebte seine Familie. Er tanzte. Und er trank.
Ich erinnere mich an einen Morgen, als der Supermarkt am Eck gerade aufgesperrt hatte und ich für sein Frühstück ein Sechsertragerl holen ging. Wir erwarteten einen seiner besten Freunde, den ich kennenlernen sollte. Ich stand an der Kasse und wollte bezahlen, als mich von hinten jemand ansprach: „Du bist bestimmt J.'s Freundin.“ Es war sein Freund, der mich anhand meines Einkaufs haargenau zuordnen konnte. Weil er J. kannte und wusste, was J. frühstückte. Weil der Erinnerungspositivismus ein Hund ist, kann ich mich an das Gesicht des Freundes nicht mehr erinnern. Die Anekdote ist geblieben, weil ich mich plötzlich sehr verstanden fühlte.
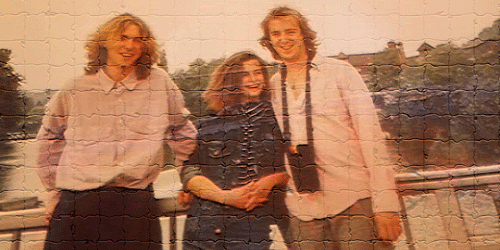
Nämlich darin, dass das Maß voll wurde. Nicht nur in der Früh, sondern allgemein. Ich hatte mir monatelang angeschaut, wie er seine Talente klein- und die Verzweiflung über seine Umstände großredete. Er streichelte quasi die Katze, die sich in den Schwanz biss. Immer und immer wieder. Weil er als halber Österreicher und halber Brite in sich zerrissen war. Er konnte weder ohne das eine noch ohne das andere. Das letzte Foto, das mich erreicht, zeigt ihn in einem Leiberl der englischen Nationalmannschaft. Fußball war ihm alles. Fernsehen auch. Er hätte sich dort gut gemacht, smart wie er war. Irgendwann konnte ich trotzdem nicht mehr hoffen.
Jetzt hat seine Verzweiflung am Leben ein Ende, und auch wenn es mich unendlich traurig macht, dass er seine Talente nicht zu seiner Zufriedenheit ausschöpfen konnte, habe ich das Gefühl, dass es ihm jetzt besser geht. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte, waren wir Mitte 20 und die Hoffnungen groß, dass er sich in eine gute Richtung entwickeln würde. Damals sind wir ohne Gram voneinander geschieden. Ich denke, ich werde mich ein weiteres, letztes Mal von ihm verabschieden, wenn es irgendwie geht. Auf die Frage, ob das eine gute Idee sei, meinte einer seiner Freunde: „In his words: I think you're welcome.“ Und erzählt mir, dass J. ihm bei seinem letzten Besuch die Hymne des FC Liverpool vorgespielt hat. „ You never walk alone “ wird ihn auf seinem letzten Weg begleiten, da bin ich sicher.
Mehr Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.