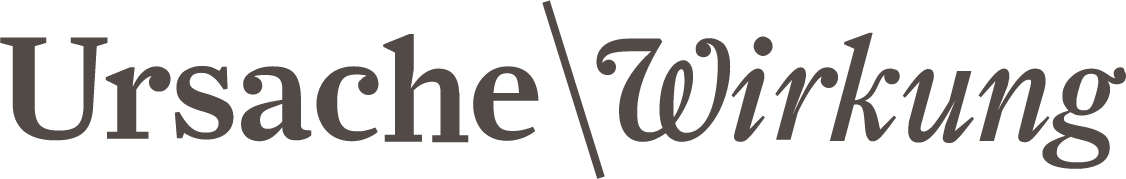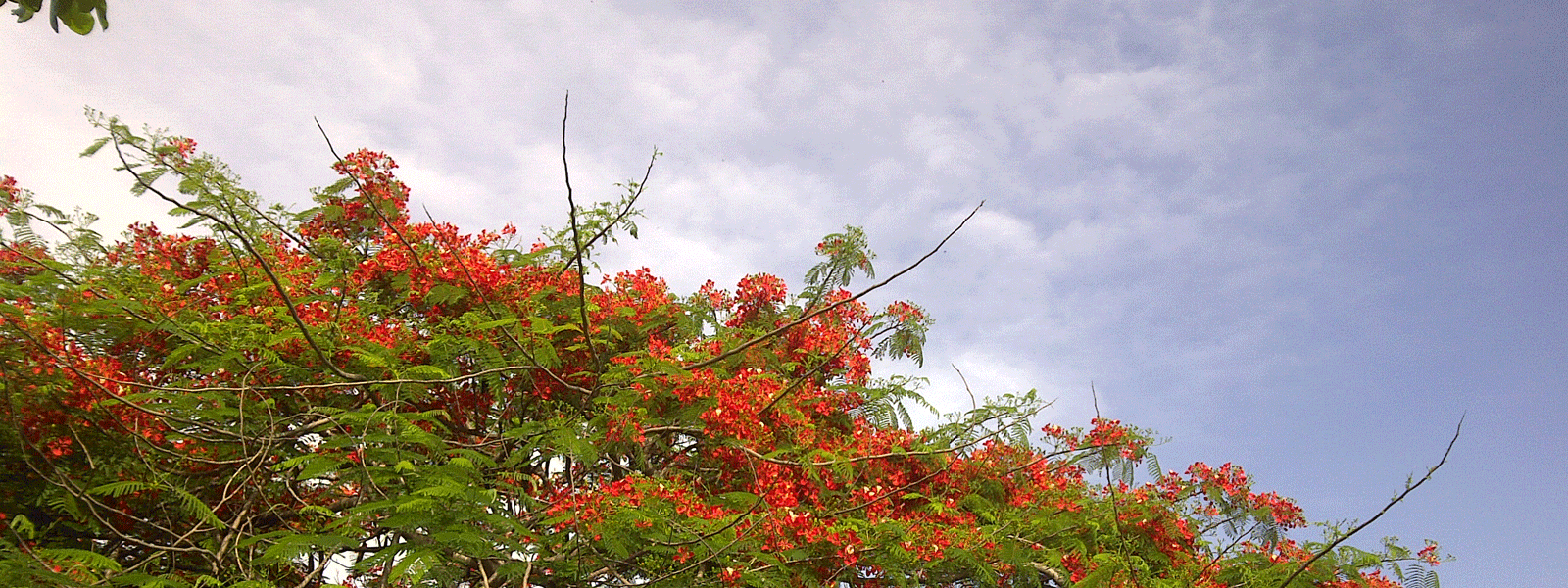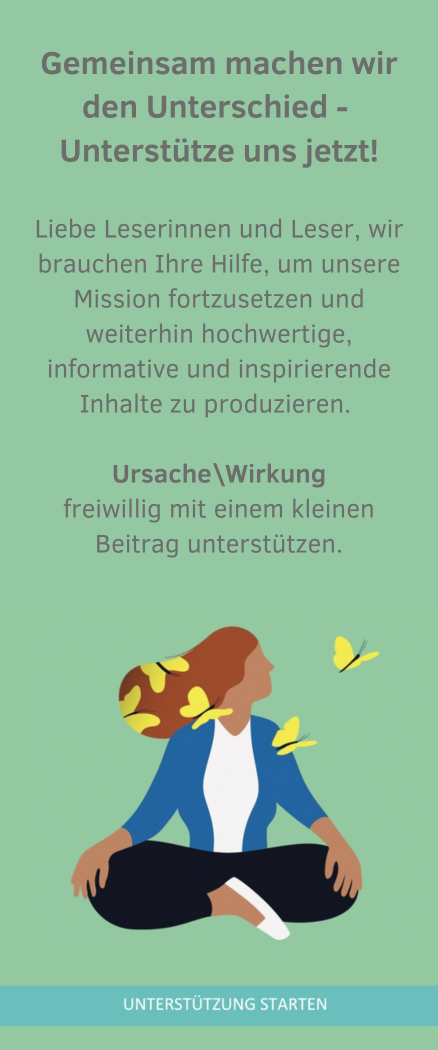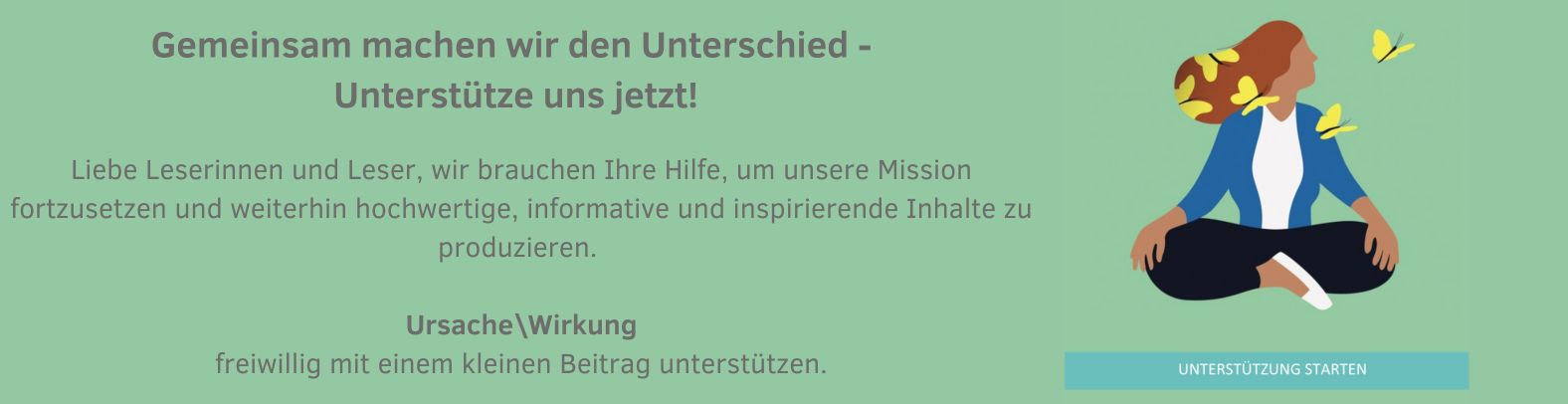Die Tatsache, dass ich mich letzte Woche wieder von etwas getrennt habe, versetzt mich jetzt in die Lage, das, was ich behalten habe, umso kritischer zu beäugen.
Vielleicht kennen Sie das Phänomen: Kaum lässt man das eine los, erwischt man sich dabei, an anderer Stelle zu klammern. Ich kann zwar fünf Kilo meiner Lieblingswochenzeitung wegwerfen, dafür aber echt bockig werden, wenn ich einen lieben Freund per Verordnung in der Öffentlichkeit nicht umarmen darf. An dieser Stelle ist „klammern“ wörtlich zu nehmen. Und ob der aktuellen Situation bin ich fast schon chronisch bockig, was mich wundert. Denn wochenlang habe ich meinem Alleinsein gefrönt und alles ganz wunderbar gefunden. Doch langsam wird es widersinnig. Schon alleine die Aussage, dass man Abstand halten solle, aber nur dort, wo es möglich sei. Eine Freundin erzählt mir von ihrer Fahrt in der Wiener U-Bahn, wo sie eigenhändig zwei Streithähne auseinanderdividiert hat, weil die sich ob der Mund-Nasen-Bedeckung fast in die Haare gekriegt hätten, nachdem halbe Myriaden von Menschen sich Haut an Haut durch die Gänge geschoben hatten. Vielleicht sollte ich meine Freund*innen auch nur mehr in der U-Bahn treffen, denn wenn man ohnehin schon gegeneinander schrammt, kommt es auf eine Umarmung mehr oder weniger auch nicht an, oder?
Doch bevor ich mich wieder einmal in Rage rede – einmal am Tag genügt, und dieses eine Mal habe ich heute schon hinter mir -, will ich wieder zu meiner Lieblingswochenzeitung zurückkehren. Stellen Sie sich vor: Ich lese die aktuelle Ausgabe! Und bleibe an einem Artikel hängen, der sich mit einem Vergleich der jetzigen Situation mit einer im 18. Jahrhundert beschäftigt. Damals hatte man das Social Distancing auch schon praktiziert, zwar nicht aufgrund von Epidemien, sondern aufgrund der Erkenntnis, dass sich Krankheiten durchaus von Individuum zu Individuum übertragen lassen. Vor dieser Zeit glaubte man an körperliche Unausgewogenheiten als Ursache, die absolut intrinsisch waren. Aus dieser Zeit stammt übrigens der Gebrauch von Nachtwäsche, Besteck und Taschentuch. In einem ersten Schritt bedeutet das: Die Gesellschaft hat schon einmal einen Individualisierungsschub durchgemacht. Nach Ansicht des Autors brauchen wir uns nicht über die aktuellen Tendenzen aufzuregen, denn sie sind im Prinzip nichts Neues, sondern nur die leicht verschärfte Version dessen, was sich ohnehin bereits angekündigt hat. Und dann kommt ein ganzer Absatz im Nominalstil, der die bis dahin kraftvolle Ausdrucksform des Journalisten in das übernächste Universum beamt. Verödung, Einübung, Zuwachs, Entstehung, Machtzuwachs – das muss doch wirklich nicht sein. Ist es denn so schwer, den Menschen zu erzählen, dass viele Kleinunternehmen schließen werden und jene, die dort arbeiten, kaum mehr genug zum Leben verdienen werden? Nein, da spricht man von Niedergang. Man könnte auch sagen, dass immer mehr Menschen sich auf Beziehungsportalen und erotischen Tauschbörsen kennenlernen werden. Aber nein, der Zuwachs muss herhalten. Wobei sich mir ja die Frage stellt, was man denn im virtuellen Raum so tauscht – aber vielleicht bin ich viel zu materialistisch, um in diesem Kontext auch nur einen Hauch von Fantasie entwickeln zu können. Und wenn das Thema schon angeschnitten ist: Einübung der Umgangsweisen eines kühleren und berührungslosen gesellschaftlichen Verkehrs – wow!

Was sagt es denn über uns aus, dass wir einen kühleren Umgang miteinander üben müssen? Und ich frage das jetzt nicht den Gastronomen meines Vertrauens, der sowieso von jedem seiner Gäste mindestens einmal mehr oder weniger intensiv geküsst wurde. Dass er sich über die neue Coolness freut, kann ich mir lebhaft vorstellen. Machen Sie mal einem Semibetrunkenen klar, dass sein Atmen schlecht und die damit verbundene Körperflüssigkeit auch keinen Deut besser ist! Dass er sich diese Diskussionen damals ersparen wollte und jetzt ersparen kann, ist nachvollziehbar. Doch jemand, der nicht im Mittelpunkt von geistreichen Sympathiekundgebungen steht, sollte doch ohnehin ein Gespür dafür haben, von wem er sich angreifen oder abbusseln lässt. Oder nicht? Wieder einmal ein Pippi-Langstrumpf-Moment? Die Freundin aus der U-Bahn, eine pensionierte Krankenschwester, umarmt auch, sieht aber vom Küssen ab. So geht es doch auch. Interessant wird die Einübung des berührungslosen gesellschaftlichen Verkehrs. Angenommen, ich verliebe mich in einen Mann, während ich doch genau das Gegenteil üben sollte. Ist dann alles, was übrig bleibt, eine spirituelle Partnerschaft, bei der das höchste der Gefühle eine geistige Vereinigung ist? Nicht dass ich das nicht kennen würde und dem etwas abgewinnen könnte – doch wo sollen sich denn dann künftig die Kinder einnisten? Mit Kopfgeburten wird die Menschheit nicht überleben können. Oder kriegen jetzt nur mehr jene Paare Kinder, die vor der Epidemie schon Tisch und Bett geteilt haben? Was für ein Druck! Das ist schon nahe an der Massenproduktion. Oops, in die Nominalstilfalle gegangen.
Sie sehen, meine schäfchenartige Gelassenheit aus dem März 2020 hat Feuer unter dem Allerwertesten bekommen. Und dieses Feuer wird jetzt am Glühen gehalten und darf überall Funken sprühen, wo es einen Lufthauch mehr erhaschen kann. Mehr als „erlaubt“, mehr als „geplant“, mehr als „gesund“. Mein rebellisches Ich ist wieder da, und bei aller Erkenntnis der vergangenen Wochen, die vieles in meinem Leben zum Guten gewendet hat: Wenn man zwanghaft versucht, etwas Sinnlosem Sinn zu geben, wird es deshalb noch lange nicht sinnvoll. Besonders nicht, wenn Angst als Motivator dahintersteckt. Marianne Williamson sagt: „Sinn ist nicht etwas, das eine Situation uns gibt; es ist das, was wir einer Situation geben.“ Und das ist das wirklich Spannende in dieser Zeit, finden Sie nicht auch?
Weitere Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.