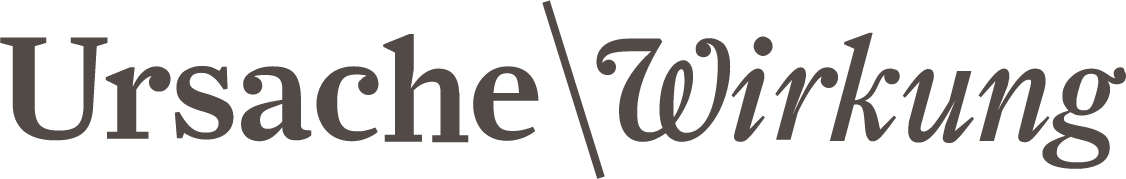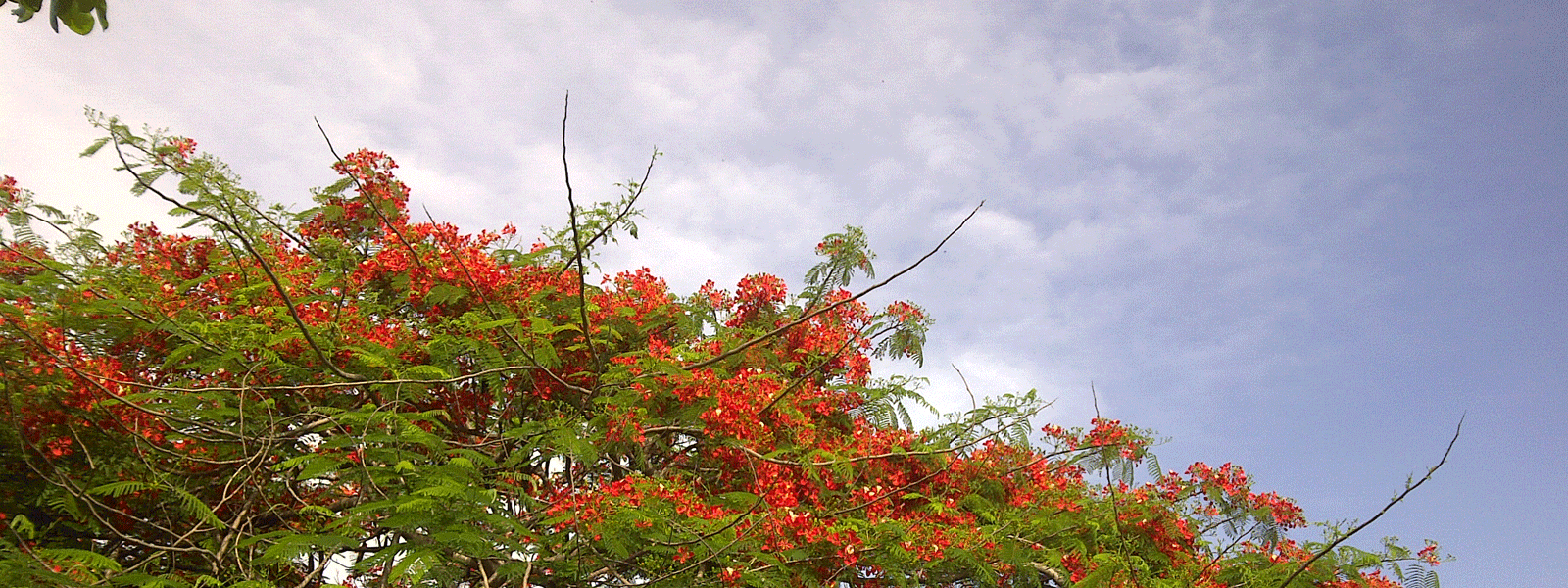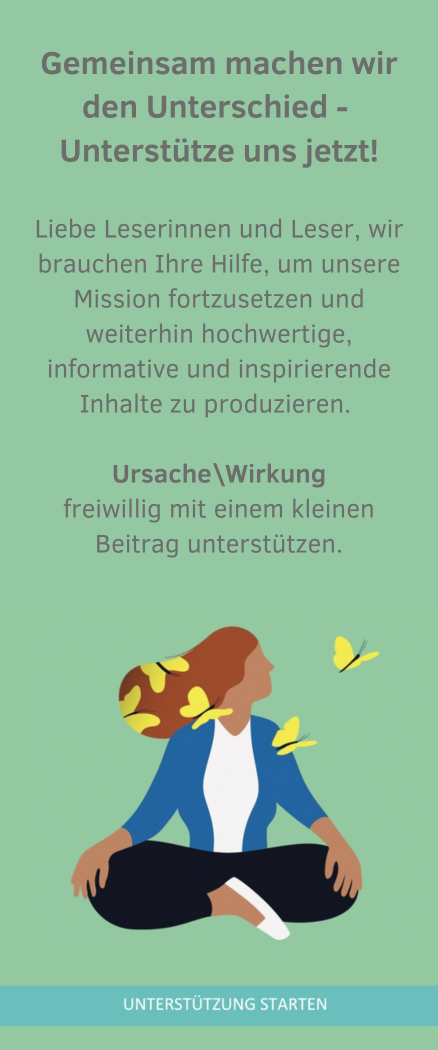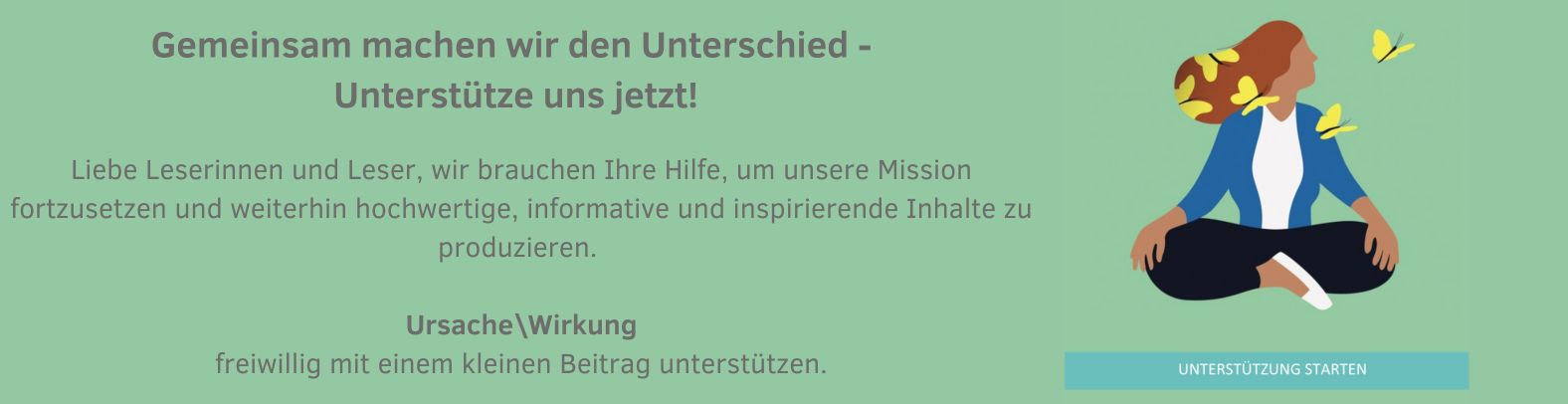Wir wurden ja dahin gehend eingegroovt, dass wir uns in einer neuen Normalität wiederfinden würden. Doch die ist vermutlich für jeden anders, egal, wie sehr er sich bemüht, Vor-Coronazustände herzustellen.
Der Gastronom meines Vertrauens kann es langsam angehen lassen mit dem Öffnen, denn bei Schlechtwetter ein Bier im Freien zu trinken, ist kein Regenspaziergang. Also sperrt er später auf und pünktlich zu. So gewöhnt er sich gemütlich ans Arbeiten. Mein Kreuz wird sich wieder ans Bauchtanzen gewöhnen dürfen, und das Ischialgische dürfte bald verschwinden. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich wieder aufs Tanzen freue. Es gibt mir das Gefühl einer Vor-Coronanostalgie. Denn das es anders sein wird als vor vielen Monaten, ist mir klar. Ganz einfach deshalb, weil ich anders bin.
Das hängt jetzt nicht mit den Coronakurven des Körpers zusammen, sondern mit dem Drumherum. Ich habe beschlossen, statt mit dem Bus mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren, weil ich da weniger Zeit in einem Öffi verbringen muss. Das Gute daran: Der Spaziergang zum Studio entlang des Flusses dauert länger und wärmt mich fürs Hüftschwingen auf. Unsere Truppe wird kleiner sein, weil eben nur eine überschaubare Anzahl von Damen umeinander herumwirbeln darf. Dem Spaß wird das in keiner Weise abträglich sein, da bin ich sicher. Und das Nachfüllen der rausgetanzten Flüssigkeit danach wird auch moderat verlaufen, denn in drei Stunden kann man sich zwar strategisch ausreichend betrinken; sinnvoll ist etwas anderes. Vor allem, wenn man sich das Kampftrinken in einer Zeit abgewöhnt hat, in der andere erst so richtig Geschmack daran gefunden haben. Der Gastronom meines Vertrauens wird mich trotzdem weiterhin liebevoll „kleines Miststück“ nennen.
Als ich mit einer Freundin zusammensitze, sprechen wir darüber, was denn bei offenen Konzerthallen, Kinosälen und Gastronomiebetrieben anders werden könnte in unserem Leben. Ob wir der Versuchung widerstehen können, unsere Terminpläne wieder gnadenlos zuzupflastern, weil so viel passiert, was unsere Aufmerksamkeit fesselt. Weil wir uns eben in den vergangenen Monaten in ein Leben gefunden haben, das uns großteils entspricht. Und das konnte deshalb gedeihen, weil wir auf uns selbst zurückgeworfen waren und praktisch mit der Gelegenheit beschenkt wurden, unseren ganz persönlichen Weg zu finden. Und im Grunde sind wir uns einig, dass wir auch weiterhin auf diesem Pfad bleiben wollen. Auch wenn es schwer werden könnte.

Einer Verlockung bin ich theoretisch schon erlegen, nämlich der des Kinobesuchs. Allerdings steht er noch nicht ultimativ fest, weil meine Begleitung hoffentlich ihrer Gesundung den Vorrang geben wird vor neunzig Minuten Munkeln im Dunkeln. Tod hin, Meteoriteneinschlag her. Wenn ich etwas gelernt habe in den vergangenen Monaten, dann ist es das: Unsere Gesundheit sollte uns über alles gehen. Nie war es wichtiger, auf das Wohlbefinden zu schauen; verabsäumen wir das, hilft die beste Impfung nicht.
Mein Terminkalender ist bis Mitte Juli nahezu voll. Und das steht in keinem Widerspruch zum oben Ausgeführten. Denn er beinhaltet sehr viel Me-time. Das bedeutet: Ich habe soziale Tage und Tage, wo ich meinem eigenen Rhythmus folge, meine Gedanken denke. Meine Freundin meint, dass das eine Sache des Alters ist; ich glaube, es ist eine Sache von Bewusstheit. Wenn ich bewusst Menschen treffen möchte, sollte ich im Augenblick sein können und meine Gedanken nicht immer in andere Richtungen abdriften sehen. Umgekehrt: Wenn ich meinem Rhythmus folge, soll kein anderer den Takt vorgeben. Das ist für mich Balance.
Schon im Frühjahr letzten Jahres hatte ich bedauernde Momente bezüglich der „Öffnung“, die sich im Laufe der Zeit auswuchsen. Damals führte ich das auf den Workload zurück, der an meinen Energiereserven nagte. Heute weiß ich: Ich kann nur ein beschränktes Kontingent an Aktivitäten leisten. In jeglicher Richtung. Weil ich gelernt habe, dass das Leben nur dann schön ist, wenn man sich mit etwas aus vollem Herzen beschäftigen kann. Sich hineinwerfen kann. Sich hingeben kann. Mit drei Treffen am Tag, fünf Bieren und vier Stunden Schlaf wird das nichts. Ja, ich bin über 50, aber über die Straße helfen braucht mir noch keiner. Weil ich den Weg nach Hause inzwischen selber und rechtzeitig kenne. Das Leben im Innen hat an Bedeutung gewonnen, mein Leben im Außen wenig verloren. Deshalb habe ich mir eine neue Hängematte geleistet. Sie hängt im Innen. Wenn es im Außen regnet, kann ich die Fenster öffnen und trotzdem schaukeln. Das ist meine neue Normalität, in der vollkommenen, wenn auch schutzbedürftigen Balance zwischen Auszug und Rückzug.
Weitere Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.
Bild © Pixabay