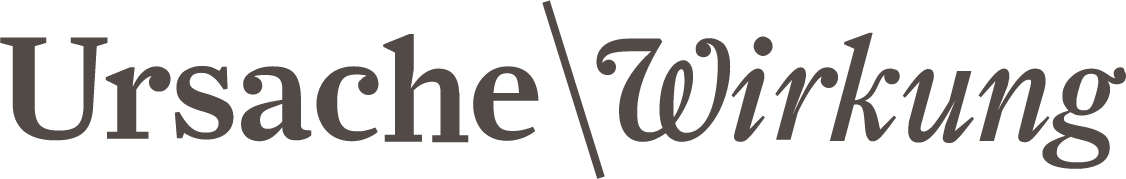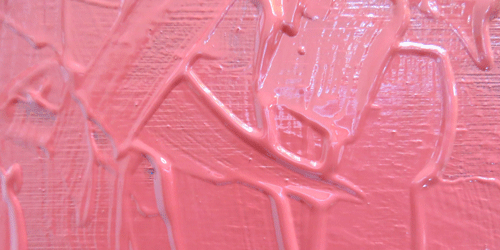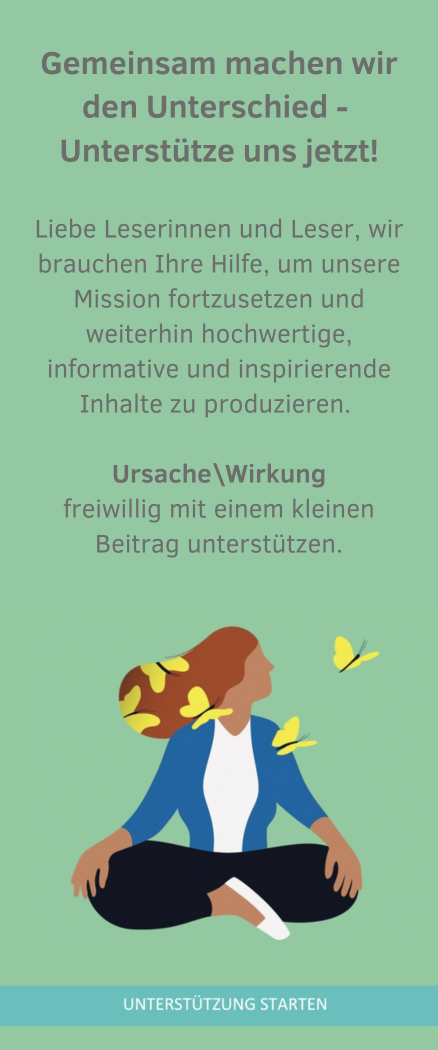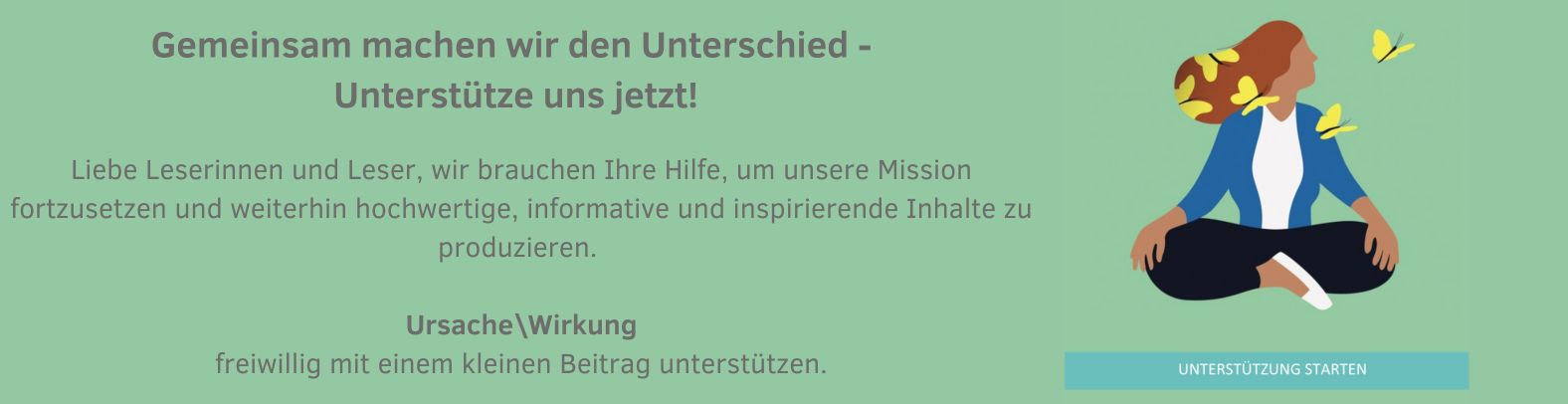Im Menschen verbinden sich Emotionen und Vernunft. Was wie entsteht und welches Problem mit Entscheidungen verbunden ist.
Vermutlich schon sehr bald, seit die Menschen von Geist beseelt wurden, als wir also in unserer langen Entwicklungsgeschichte zum ersten Mal uns selbst als eigenständige Individuen begriffen haben, stellten wir uns auch die Frage, wie unser physischer Körper und dieses immaterielle Bewusstsein miteinander verbunden sind.
Im 17. Jahrhundert wurde diese Frage vom französischen Philosophen René Descartes erstmals als Leib-Seele-Problem explizit formuliert, doch das Nachdenken darüber ist bereits aus der Antike dokumentiert. Alle Jenseitsvorstellungen – ganz gleich, ob einen danach ein Paradies oder die Seelenwanderung erwartet – gehen davon aus, dass eine Seele, die den Tod des Körpers überlebt, etwas anderes sein muss als der Körper selbst.
Descartes legte mit seinem bekannten Zitat „Ich denke, also bin ich“ die Grundlage für ein viele Bereiche der Gesellschaft bis heute dominierendes Vernunftdenken. Immanuel Kant spitzte dies in seinen Werken noch weiter zu: Erkenntnis ist nur durch Vernunft möglich. Durch Nachdenken können wir unsere Sinneswahrnehmung der Welt korrigieren, weil wir die sensorischen Beschränkungen unseres Körpers erkennen und diese mit rationalem Denken ausgleichen können.
Erkenntnis ist nur durch Vernunft möglich.
Das Erbe dieses Paradigmas hat vor allem die Medizin geprägt, die sich vorrangig auf die Physiologie und Pathologie des menschlichen Körpers konzentriert hat. Das Gehirn hingegen, so formuliert es der Neurowissenschaftler Antonio Damasio, also das gesamte Nervensystem wurde in diese Bemühungen nur deswegen einbezogen, weil es neben Herz und Lunge ein weiteres Organ darstellt. Doch für die wertvollste Funktion des Gehirns, nämlich den Geist, brachte die Schulmedizin bis heute wenig Interesse auf. Es ist jedenfalls ein seltsamer Tatbestand, dass Studierende in Psychopathologie unterrichtet werden, ohne je etwas über die Funktionsweisen der geistigen und emotionalen Normalität erfahren zu haben. In unserer westlichen Welt gelten daher Gefühle als meistens störende Überreste einer Evolutionsgeschichte, die man besser überwinden sollte, wenn man sich nicht zum sprichwörtlichen Affen machen will.
Doch wie würde sich ein solcher Mensch, der keine Emotionen kennt, in unserer Gesellschaft verhalten? Wären seine Entscheidungen besser, weil von keinen Gefühlen beeinflusst? Die moderne Neuropsychologie erforschte Menschen, deren emotionales und soziales Verhalten durch Verletzungen in entsprechenden Bereichen des Gehirns beeinträchtigt war. Bei Tests zu Intelligenz, Gedächtnis und Wahrnehmung schnitten diese Patienten weiterhin gut ab und konnten sich klar und präzise verständlich machen. Doch in anderen Lebensbereichen, die Planung benötigten, waren diese nicht mehr in der Lage, einfache Entscheidungen zu treffen.
Fragte man die Patienten zum Beispiel, was sie abends essen wollten, dann verloren sich diese in endlosen Grübeleien oder wollten darauf nicht antworten, weil diese Frage aus ihrer Sicht bedeutungslos war. Zeigte man ihnen Bilder mit beängstigenden, gewalttätigen Szenen, dann reagierten diese Leute völlig emotionslos. Befragte man sie im Detail zu ihren Wahrnehmungen, dann beschrieben sie die Inhalte mit derselben Leidenschaftslosigkeit, wie sie es angesichts eines Fotos von einer Hauswand oder einem Tisch taten. Einen Ratschlag, wie sich zum Beispiel jene Leute verhalten sollten, die in einem brennenden Haus eingeschlossen waren, konnten sie hingegen nicht geben. Der Ausfall jener Gehirnregionen, die für Gefühle zuständig sind, scheint daher durchaus die Fähigkeit zu beeinträchtigen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Unser Geist ist also keineswegs losgelöst vom physischen Körper, wie es in der Doktrin vom Rationalismus dargestellt wird.
Doch wie und wo entstehen Gefühle? Eine kurze Beschreibung, was passiert, wenn Sie beispielsweise vom Tod eines guten Freundes erfahren: Ihr Gehirn ruft blitzschnell einige Vorstellungsbilder zu diesem Menschen ab, das erinnerte Aussehen, vielleicht ein gemeinsames Erlebnis. Aber auch Erinnerungen an andere Situationen mit Todesfällen naher Menschen werden reaktiviert. Die Hirnrinde verarbeitet diese Signale und schüttet verschiedene Stoffe in den Blutkreislauf aus. Darauf reagieren verschiedene Organe des Körpers: Der Herzschlag wird schneller, die Blutgefäße erweitern sich. Das verleiht ein blasses Aussehen. Die Speichelsekretion im Mund setzt aus, die Verdauung wird kurzfristig eingestellt. Hals- und Rückenmuskulatur erhöhen die Spannung und im Gesicht erschlaffen verschiedene Muskelgruppen, was unwillkürlich den Ausdruck von Leid erzeugt. Die Summe dieser unbewussten Reaktionen bildet dann am Ende das Gefühl der Trauer.
Das klingt sehr mechanistisch und so, als ob alle unsere Empfindungen lediglich das Resultat instinktiver, neurobiologischer Reaktionen sind. Man kann diesen Reaktionsmechanismus auch noch aus evolutionsbiologischer Perspektive weiterdenken. Für sozial hochorganisierte Lebewesen wie den Menschen, der auf die Kooperation und das Vorhandensein anderer existenziell angewiesen ist, stellt der Verlust eines Gruppenmitglieds immer auch eine Bedrohung dar. Die beschriebene körperliche Anpassung ist eine passende Reaktion auf diese Situation und steigert – bei gesamthafter Betrachtung – die Überlebenschancen. Der Tod eines Sippenmitglieds hätte auch Gründe haben können, in denen das Senken der Körperspannung fatale Folgen gezeigt hätte.
An dieser Stelle mag man einwenden, dass dies auch die Vielzahl von positiven Emotionen wie Liebe, Freude oder Mitgefühl auf einen reinen Reaktionsmechanismus reduziert. Doch nur, weil es eine körperlich-organische Grundlage für unsere Empfindungen gibt, muss es diesen keineswegs an Wahrhaftigkeit fehlen. Wäre es wünschenswerter, wenn das Gefühl der romantischen Liebe nur auf Grundlage rationaler Überlegungen entsteht? Welche Rolle würde dann der Körper haben? Wäre er eine Art Vehikel für den Geist, der die Gliedmaßen und Organe so wie ein Kranfahrer von seiner hohen Kanzel aus bedient?
Der Umstand, dass menschliches Handeln biologische Grundlagen hat, macht uns nicht zu Robotern, sondern zeigt die untrennbare Verbindung zwischen geistigen und körperlichen Prozessen. Besonders deutlich zeigt sich das auch in sehr alltäglichen Situationen, zum Beispiel, wenn wir fotografiert werden. Die übliche Aufforderung, freundlich zu lächeln, will uns dabei aber oft nicht gelingen. Beim echten Lächeln kontrahieren wir sowohl die Augenringmuskeln als auch die Jochbeinmuskeln, die unsere Mundwinkel anheben. Beide Impulse kommen aber aus verschiedenen Hirnregionen.
Versuchen wir quasi grundlos, also willkürlich zu lächeln, dann können wir nur den Jochbeinmuskel steuern, die Augenregion entzieht sich unserer Kontrolle. Alle Versuche, dies aktiv zu erzwingen, führen nur zu einem bestenfalls erschreckten Gesichtsausdruck mit weit aufgerissenen Augen. Man kann aber – und dies tun gute Schauspieler – seine Erinnerungen an erlebte Situationen abrufen, in denen man lächeln musste, und so über diesen Umweg die unwillkürliche Muskulatur ansteuern.
Der grundsätzliche Zweck unseres Denkens ist fast immer, Entscheidungen treffen zu können und auf dieser Basis entsprechend zu reagieren. In manchen Situationen ist es sinnvoll, wenn wir ohne kognitive Prozesse auskommen. Haben wir einige Stunden nichts gegessen, sinkt unser Blutzuckerspiegel. Neuronen melden dies an den Hypothalamus, einem Teil des Zwischenhirns, der wiederum durch weitere Nervenimpulse Hungergefühl bei uns entstehen lässt. Bewusst denken müssen wir dabei erst, wenn wir entscheiden sollen, ob wir zum Kühlschrank oder in ein Restaurant gehen sollen.
Etwas anders liegt der Fall, wenn wir uns vor einem auf uns zufahrenden Auto in Sicherheit bringen müssen. Wir könnten auf diese Situation durch Ausweichen oder lautes Schreien reagieren. Aufgrund unserer erlernten Erfahrungen wird das Gehirn diesen optischen Auslösereiz mit der besten Reaktion, wie etwa ausweichen, automatisiert ablaufen lassen. Auch in dieser und in weiteren vergleichbaren Alltagssituationen reagieren wir ebenfalls ohne Kognition.
Der grundsätzliche Zweck unseres Denkens ist fast immer, Entscheidungen treffen zu können.
Anders verhält es sich aber bei zahllosen Entscheidungen, die wir regelmäßig treffen: Sollen wir eine Einladung zum Essen annehmen, wohin wollen wir auf Urlaub fahren oder welche Partei sollen wir wählen? Im Unterschied zu den ersten beiden Beispielen müssen wir beim dritten aufgrund von Fakten logische Schlussfolgerungen ziehen und ausschließlich die Vernunft entscheiden lassen. Aber stimmt dies wirklich? Man denke an die erwähnten Patienten mit Schädigungen im Bereich der Gefühlszentren: Sie waren unfähig, diese scheinbar vordergründig logischen Entscheidungen zu treffen. Selbst ein Computer würde angesichts der Fülle von Daten, möglichen Aspekten und Ungewissheiten keine sichere Antwort geben können.
Letztlich treffen wir auch solche Entscheidungen, wie zahlreiche Studien dazu gezeigt haben, aus dem Bauch heraus, was wiederum einem gefühlsbasierten, unterbewussten Denkprozess entspricht. Das soll allerdings keine Geringschätzung der intellektuellen Leistungen der Menschheit bedeuten, sondern nur bewusstmachen, dass Menschen wie auch andere Lebewesen ihre Umwelt mit besonderen Strategien bewältigen. Angesichts der zunehmend komplexen Herausforderungen, denen sich die menschliche Gesellschaft stellen muss, können wir uns aber nicht mehr allein auf unsere biologisch vorgegebenen Reaktionsweisen verlassen, wir brauchen indes suprainstinktive Überlebensstrategien, die sich in unserer Gesellschaft entwickelt haben und die durch das, was wir Kultur nennen, vermittelt werden.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 103: „Buddha und die Arbeit"
Bild Teaser & Header © Pixabay