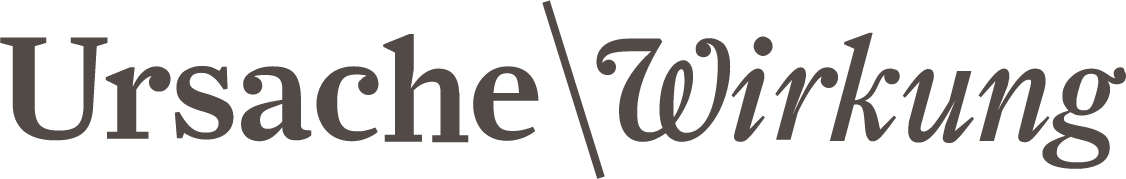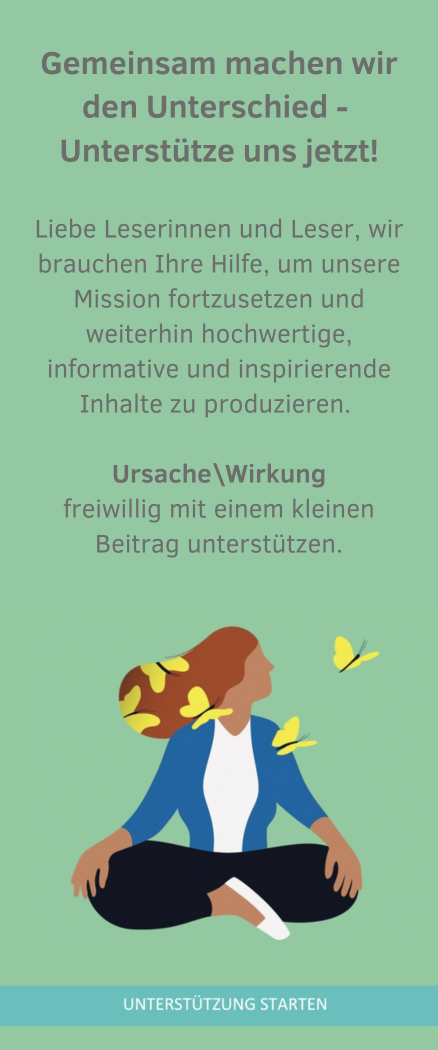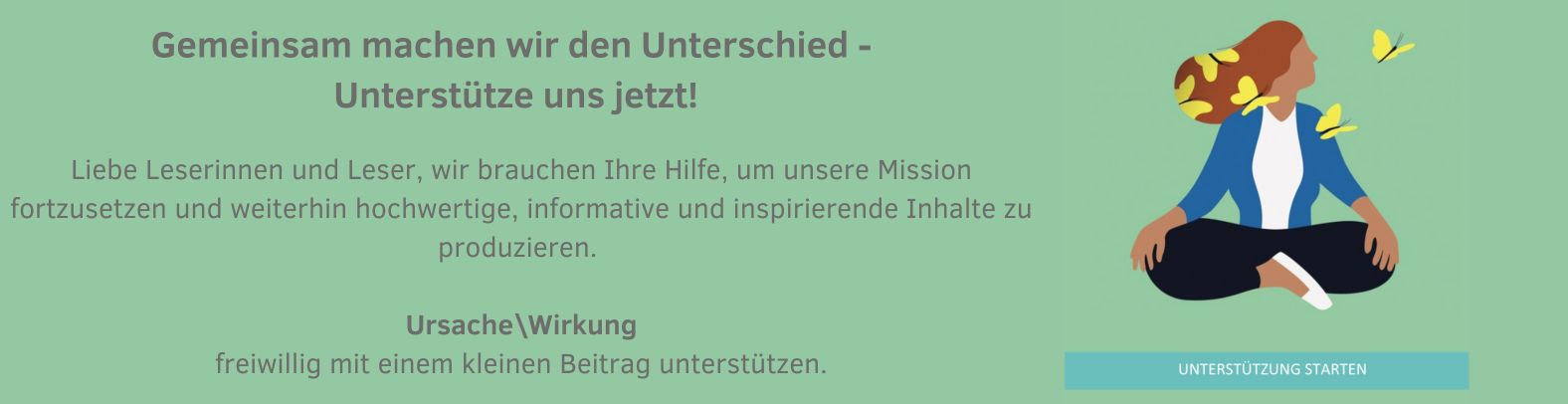Seit jeher versucht sich der Mensch, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ob der moderne Fortschritt dabei hilft? Eine Reise durch die Jahrhunderte.
Gerade in Zeiten einer globalen Krise, wie wir sie gerade erleben, stellt sich die Frage: Was ist ein gutes Leben? Hinter den alles dominierenden Nachrichten über Infektionen, Todesfälle und der durch Unsicherheit erzeugten Panik lugen auch andere Aspekte hervor: Für viele ist die stete Hektik eines auf Produktion und Konsumation ausgerichteten Alltags zurückgegangen, Verkehrslärm und -abgase sind weniger geworden und verschiedene Tierarten rücken in die nun von Menschen verlassenen Zonen vor.
Die Frage, wie man am besten leben soll, beschäftigt uns, seitdem Menschen ein reflektierendes Bewusstsein entwickelt haben. Und viele Fragen, die wir uns als Menschen stellen, lassen sich mit einem Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte besser verstehen.
Theodosius Dobzhansky, einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen des 20. Jahrhunderts, formulierte diese Erkenntnis in seinem bekannten Essay: „Nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Licht der Evolution!“.
Blicken wir daher um etwa 100.000 Jahre zurück in eine Zeit, in der unsere Vorfahren als nomadische Jäger und Sammler in der offenen Savannenlandschaft Afrikas lebten. Sowohl der Homo sapiens als auch andere vormenschliche Primaten sind von ihren körperlichen Fähigkeiten her eher benachteiligte Lebewesen. Weder können wir so schnell laufen wie andere Tiere, um Räubern zu entkommen, noch verfügen wir über Klauen, scharfe Reißzähne oder ausreichend Muskelmasse, um uns gegen diese zu wehren.
Unsere eigentliche Stärke lag damals und auch heute vor allem in der Fähigkeit zur Kooperation. Durch Beobachtungen an jenen Naturvölkern, die auch heute noch so leben, konnten Anthropologen unser steinzeitliches Leben plausibel rekonstruieren: Ein Clan bestand aus maximal fünfzig Mitgliedern, die nur gelegentlich Kontakt mit anderen Gruppen hatten. Innerhalb einer Gruppe lebte man in engem persönlichen Kontakt. Aufgrund der wandernden Lebensweise war materieller Besitz eher Belastung als von Vorteil. Wichtig war es, die Beute zu teilen, wobei sehr genau darauf geachtet wurde, wer anderen etwas abgab. Solche Mitglieder standen in höherem Ansehen als jene, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren. Hierarchien waren flach, mehr galt die Erfahrung der Älteren, die die Routen des Wilds kannten oder wussten, wie man Krankheiten heilt. Ein „Arbeitstag“ hatte kaum mehr als vier Stunden, dann waren die existenziellen Bedürfnisse gestillt. Das Leben in diesen Zeiten war weitgehend egalitär und demokratisch organisiert. Wir würden es ein gutes Leben nennen.
Doch das änderte sich grundlegend mit dem Übergang zur sesshaften Lebensweise in Agrargesellschaften. Vermutlich beendete ein Klimawandel vor 12.000 Jahren diesen paradiesischen Zustand, der in Kombination mit Überjagung der Tierbestände eine Anpassung der Lebensweise erzwang. Ackerbau war harte Arbeit, die täglich zwölf bis vierzehn Stunden erforderte und die von unvorhersehbaren Wetterbedingungen abhängig war. Gleichzeitig entstand die Vorstellung von Besitz, denn man musste sein Gebiet jetzt auch noch vor anderen schützen.
Das sesshafte Leben veränderte auch die Menschen. Von Skelettfunden wissen wir, dass diese Menschen kleiner und schlechter ernährt waren und zudem auch früher starben. Durch das enge Zusammenleben mit domestizierten Tieren sprangen Krankheiten – so wie jetzt das Corona-Virus – auf die Bauern über. In unserer Zeit haben wir die Situation, dass sechzig Prozent der Infektionskrankheiten bei Menschen regelmäßig von bestimmten Tierarten auf uns und wieder zurück auf diese übertragen werden. Die hygienisch schlechte Haltung der Haustiere auf engem Raum befeuert die Übertragung von Krankheiten und lässt Viren besonders rasch mutieren. Masern haben sich aus dem Rinderpestvirus entwickelt, sämtliche Formen der Vogelgrippe haben ihr Reservoir in der Geflügelhaltung, und die Pest konnte sich durch bakterientragende Nagetiere global ausbreiten.

Landwirtschaft erzeugte erstmals Überschüsse, die Tausch und Handel notwendig machten. Dadurch wurden aber auch Kontakte mit anderen, bisher entfernten Gruppen enger sowie häufiger, und die Immunsysteme hatten es mit immer neuen Erregern zu tun. Die Besiedelung der beiden Amerikas zeigte uns in neuerer Zeit, wie fatal sich die Übertragung von Krankheiten auf die dortigen Ureinwohner auswirkte. Durch die für diese völlig neuen viralen Erreger von Pocken, Grippe, Masern – die ihre Ursprünge in der Tierhaltung hatten – starben große Teile der indigenen Bevölkerung.
Inkas, Azteken und andere amerikanische Kulturen kannten zwar ebenso pflanzliche Landwirtschaft, aber in Südamerika gab es kaum domestizierbare Tierarten. Lediglich das Lama und in Mexiko der Truthahn wurden gezüchtet, aber nicht in großen Herden gehalten. Hätte es nur Nachteile aus einer landwirtschaftlichen Lebensweise gegeben, dann wäre die Menschheitsgeschichte sicher anders verlaufen. Aber es gab auch Vorteile.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 112: „Für eine bessere Welt"
Die schon erwähnten Überschüsse an Nahrung ermöglichten es den Besitzern erstmals, andere Menschen für sich arbeiten zu lassen. In Jägergesellschaften wäre es undenkbar gewesen, dass der Stammesälteste sich nicht an der Nahrungsbeschaffung beteiligt, sondern sich nur bedienen lässt. Jetzt bildeten sich hierarchisch differenzierte Gesellschaften heraus, was die Ungleichverteilung von Ressourcen zur Folge hatte. Ein positiver Effekt davon war dabei, dass mit diesem Freiwerden von täglicher Nahrungsbeschaffung Zeit für andere Aufgaben war. So entwickelten sich verschiedene Handwerke, erste Formen der Wissenschaft und auch die Kunst. All das führte nach etwa 130.000 Jahren der Jäger- und Sammlerkultur, nach circa 10.000 Jahren Agrarwirtschaft und 250 Jahren Industriegesellschaft zu unserer heutigen Zivilisation.
Was haben wir im Rückblick auf diese Entwicklungssprünge jeweils an Lebensqualitäten gewonnen oder verloren? Unser Leben ist im Vergleich zu einem Steinzeitmenschen sozial herausfordernder und arbeitsmäßig differenzierter geworden. Die technologischen Fortschritte haben uns von der schweren Fronarbeit auf dem Feld befreit, unsere aktive Lebenszeit verlängert und erst in den letzten Jahrzehnten durch das Internet zu einer neuen, einer weltweiten Vernetztheit geführt. Von allen Errungenschaften unserer heutigen Welt erscheint mir die industrielle Massentierhaltung die Erbsünde – um einen zentralen Begriff der christlichen Religion zu verwenden – unserer Gesellschaft zu sein. Durch Zerstörung der natürlichen Lebensräume für Weiden und Futtermittelanbau kommen wir zusätzlich in Kontakt mit Tierarten, die wie jetzt Fledermäuse das Covid-19 Virus übertragen, oder Ebola (Menschenaffen), Mers (Dromedare) oder Aids (Affenarten) verursachen. Die Probleme, die unsere Gier nach Fleisch mit sich bringt, verfolgen uns im eigentlichen Sinn des Wortes, seit wir denken können.
Bilder © Pixabay
Illustration © Francesco Ciccolella