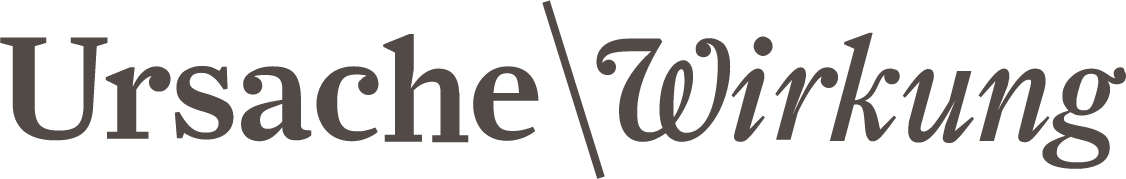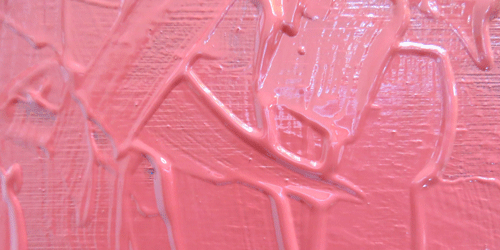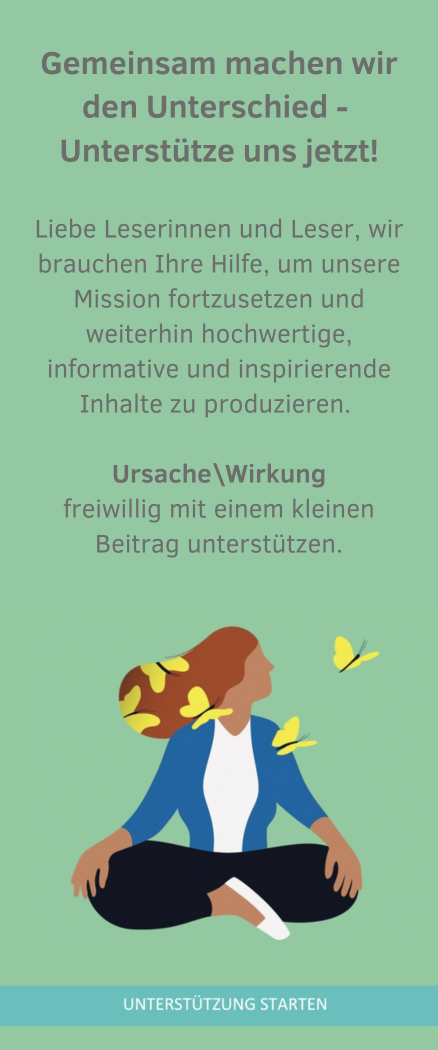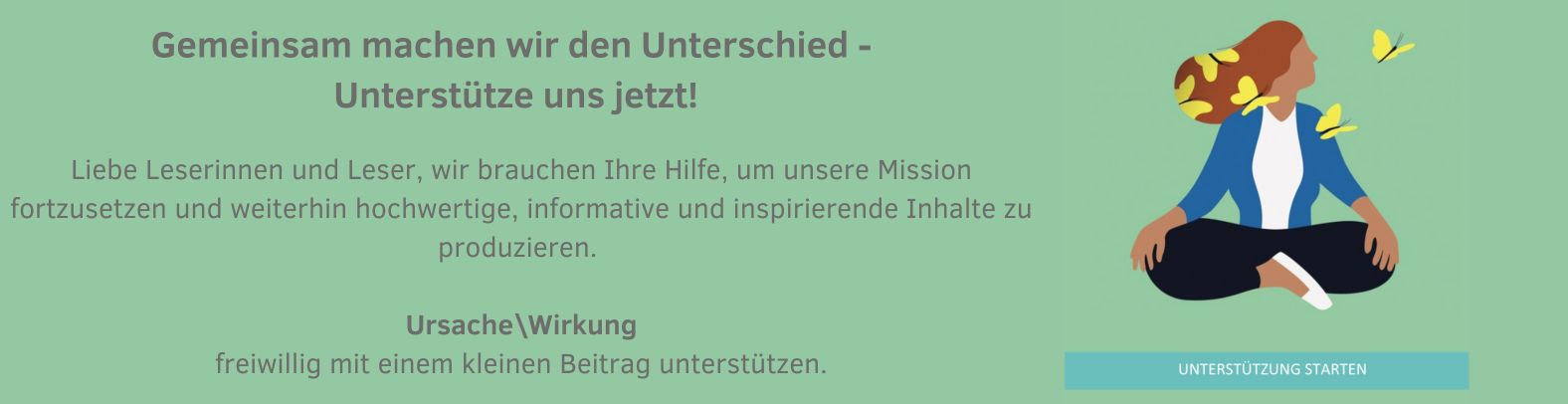Die Natur verändert sich durch neu eingewanderte Arten in Fauna und Flora, Balance ist ein Begriff, den Menschen ins Spiel bringen.
Der Ameisenbär ist ein Tier, das den Begriff der Balance wunderbar veranschaulichen kann. An seiner Lebensweise sieht man, was Ökologie im eigentlichen Sinn bedeutet. Die Tiere haben etwa die Größe eines Schäferhundes und leben im offenen Wald und in der buschbewachsenen Savanne Südamerikas. Sie streifen auf der Suche nach Ameisen- und Termitennestern vagabundierend umher. Sie sind ihre Hauptnahrungsquelle. Haben sie einen Termitenbau gefunden, reißen sie ihn mit den starken Klauen ihrer Vorderpfoten auf, um die Insekten mit ihrer klebrigen, wurmförmigen Zunge aufzunehmen. Erst wenn der Schmerz der angreifenden Ameisen unerträglich wird, lassen sie ab und ziehen weiter.
Tiere, deren Pelz zu dünn ist und die folglich die Ameisensäure nicht aushalten, verhungern. Wären die Ameisenbären aber durch einen dicken Panzer aus Hornplatten besser gegen die Ameisen geschützt, dann könnten sie die Kolonie bis auf das letzte Insekt ausbeuten. Doch dann würden sie ihre eigenen Nahrungsressourcen langfristig vernichten. Nur jene Tiere, die trotz ihrer Gier ausreichend Ameisen zurücklassen, geben der Ameisenkolonie die Chance, sich wieder zu regenerieren. Der vielfach falsch verstandene Spruch des britischen Soziologen Herbert Spencers vom „Survival of the Fittest“ meint, dass in der Natur nicht der jeweils stärkste und größte Räuber überlebt, sondern das am besten an seine Umwelt angepasste Lebewesen.
Mittlerweile reisen nicht nur Menschen mit Autos, Schiffen, Eisenbahnen und Flugzeugen um den Globus, sondern auch Tiere und Pflanzen.
Doch was bedeutet bei einer Tier- oder Pflanzenart „Umwelt“? Gibt es so etwas wie eine natürliche Heimat für die jeweilige Lebensform? Diese Frage hat in der globalisierten Welt eine immer größere Bedeutung bekommen. Denn mittlerweile reisen nicht nur Menschen mit Autos, Schiffen, Eisenbahnen und Flugzeugen um den Globus, sondern auch Tiere und Pflanzen. Manche kommen ohne Absicht als „blinde Passagiere“ in neue Länder, wie zum Beispiel die Spanische Wegschnecke, die sich mit den Gemüsetransporten aus einem kleinen Gebiet im Südwesten Frankreichs mittlerweile über ganz Europa ausgebreitet hat.
Andere Arten, vor allem Nutzpflanzen wie die Kartoffel, Mais oder die Tomate, wurden ganz absichtlich aus anderen Kontinenten eingeführt. In der Zeit des Kolonialismus importierte man zur vermeintlichen Bereicherung der heimischen Fauna exotische Tiere wie Kängurus nach England und exportierte – umgekehrt – Kaninchen, Katzen und Hunde nach Australien, wodurch sich das ökologische Gleichgewicht massiv verschob, um es freundlich zu formulieren.
Ursprünglich sprach man noch ganz wohlmeinend von Adventivarten, so als würde man die neuen Gäste freundlich begrüßen. Die Freude verging aber dann angesichts so mancher Probleme, die durch sie in der Land- und Forstwirtschaft entstanden. Deshalb entschied man sich, sie wissenschaftlich neutral als Neobiota – Neulebewesen – zu bezeichnen. Ein seltsamer Begriff mit dem Beigeschmack von Retorte und Frankenstein.
Mittlerweile verwendet man offiziell den Ausdruck „invasive Arten“. Mit dem militärischen Begriff „Invasion“ erzeugt man aber das falsche Bild einer geplanten Attacke durch feindliche Mächte. Tatsächlich war fast immer die lokale Bevölkerung aktiv oder passiv daran schuld, dass diese Lebewesen aus ihren ursprünglichen Lebensräumen verschleppt wurden. So zum Beispiel der Asiatische Marienkäfer, den man 1982 nach Europa importierte, um in Glashäusern andere Insekten zu bekämpfen. In der freien Natur hingegen sind sie konkurrenzstärker als die heimischen Marienkäferarten und stören das bestehende Gleichgewicht.
In Tirol, Österreich, beklagte man erst vor Kurzem, dass jede vierte Art, die man dort beim Spazierengehen sähe, bereits gebietsfremd sei. Dazu gehören, für viele sicher überraschend, auch ganz bekannte Tier- und Pflanzenarten wie der Fasan (Herkunft: Mittel- und Ostasien), die Regenbogenforelle (Nordamerika) oder auch der Rosskastanienbaum (Balkan).
Fast immer ist die lokale Bevölkerung aktiv oder passiv daran schuld, dass die Lebewesen aus ihren ursprünglichen Lebensräumen verschleppt wurde.
Die Diskussion, wann eine Art als invasiv eingestuft wird, ist emotional stark aufgeheizt, vermutlich auch, weil die Landwirtschaft Schäden in Milliardenhöhe meldet. In ganz Europa sollen durch unkontrollierte Einwanderungen Kosten von 12,5 Milliarden Euro pro Jahr entstehen. Hier könnte man aus Goethes Ballade, dem Zauberlehrling, zitieren: „Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los.“
Leider erinnern die Argumente sprachlich oft an die Rassenbiologie des Naziregimes: Zuwanderer verdrängen heimische Lebewesen durch Konkurrenz, Vermischung des Erbguts oder Übertragung von Krankheiten. Und auch regelmäßige Meldungen von Naturschutzvereinen haben einen seltsamen Beigeschmack: „Der Stadt Aachen gelang es, durch jährliche Arbeitseinsätze wertvolle Teile des Stadtwaldes vom Indischen Springkraut zu befreien und so die heimische Flora zu unterstützen.“

Dabei werden erwiesenermaßen längst nicht alle eingewanderten Arten zu Problemarten. Nach der sogenannten Zehn-Prozent-Regel verwildern von 1.000 neu in ein Gebiet kommenden Arten nur 100, von denen sich wiederum nur zehn dauerhaft im Freiland ansiedeln können. Letztlich verursacht von diesen zehn Prozent nur eine Art wirtschaftliche Probleme.
Dennoch sah sich die Europäische Kommission veranlasst, eine Liste mit sechzig invasiven Tier- und Pflanzenarten herauszugeben, die als Bedrohung der europäischen Artenvielfalt gesehen werden und zu deren Bekämpfung die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind.
Der Verdacht liegt nahe, dass nicht sachliche Gründe, sondern vielmehr moralische Wertehaltungen für solch heftige Reaktionen auf diese „falsche“ Natur verantwortlich sind.
Was unterscheidet erwünschte von unerwünschten Lebewesen? Offenbar ihr selbstständiges, von uns nicht gelenktes Vordringen in die freie Natur, die aber bei uns nur mehr eine Kulturlandschaft ist. Damit zeigen sich diese Zuwanderer aber als genau jener Teil der Natur, den wir sonst durch Kultivierung kontrollieren. Neobiota sind mit ihren nicht sesshaften, wild wuchernden Qualitäten somit die Antithese zu unserer Kultur und damit keine Vertreter der „guten“, sondern einer „bösen“ Natur, die von Menschen beherrscht werden muss.
Wir haben weltweit Ökosysteme durch unsere Aktivitäten aus der Balance gebracht und sehen uns nun auf verschiedenen Ebenen mit den Konsequenzen konfrontiert. Die Herausforderung dieses 21. Jahrhunderts wird es sein, die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen, um wieder ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen. Ein neues zeitgemäßes Verständnis der Beziehungen zwischen Natur und Kultur muss dabei am Anfang stehen.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.
Illustration © Francesco Ciccolella
Bilder Header und Teaser © Thomas Kelley on Unsplash