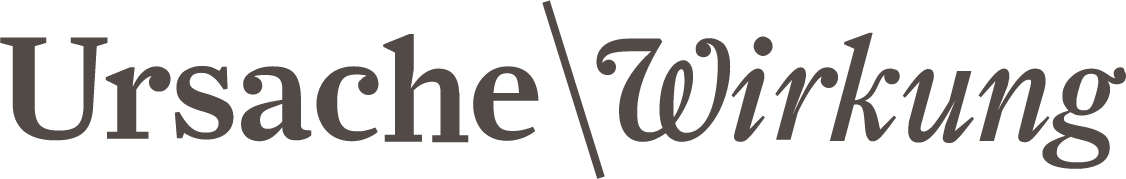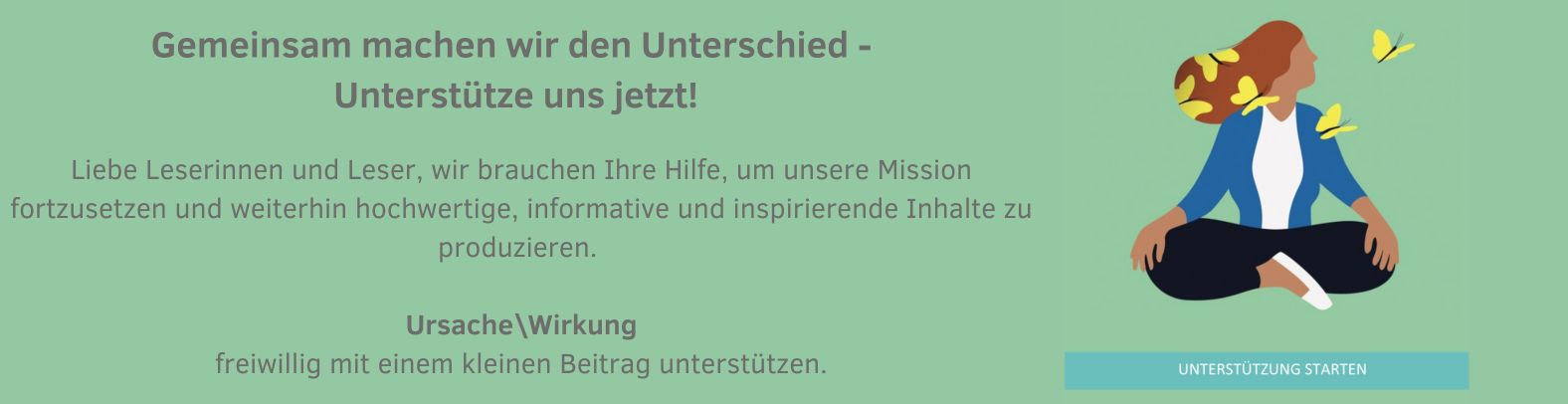Erfolgsverwöhnt war der Buddhismus im Westen: Die Vorteile der Meditation schienen neurowissenschaftlich untermauert, der Dalai Lama und Thich Nhat Hanh waren als religiöse Leitbilder einflussreicher als der Papst, und eine überwiegend wohlgesonnene Presse berichtete regelmäßig über Großereignisse und die Begeisterung konvertierter Prominenter.
 Das hat sich zuletzt deutlich verändert. Nachrichten über den Missbrauch spiritueller Macht und sexualisierte Gewalt durch besonders überschätzte Lehrer häufen sich, manche Buddha-Eventreisende schwafeln dennoch weiterhin vertuschend von völliger Hingabe in Schüler-Meister-Beziehungen, ein eitler und ungefragt küssender Lama schwadroniert sogar offen und menschenverachtend im Kasseler Lokalfernsehen über die Unterlassung von Seenotrettung, weil ihm Muslime offenkundig ein Gräuel sind. Schließlich mehren sich mit jeder Querideologen-Demo die Hinweise darauf, dass bestimmte spirituelle Formen eher platten Narzissmus fördern als Ichlosigkeit und Übernahme sozialer Verantwortung.
Das hat sich zuletzt deutlich verändert. Nachrichten über den Missbrauch spiritueller Macht und sexualisierte Gewalt durch besonders überschätzte Lehrer häufen sich, manche Buddha-Eventreisende schwafeln dennoch weiterhin vertuschend von völliger Hingabe in Schüler-Meister-Beziehungen, ein eitler und ungefragt küssender Lama schwadroniert sogar offen und menschenverachtend im Kasseler Lokalfernsehen über die Unterlassung von Seenotrettung, weil ihm Muslime offenkundig ein Gräuel sind. Schließlich mehren sich mit jeder Querideologen-Demo die Hinweise darauf, dass bestimmte spirituelle Formen eher platten Narzissmus fördern als Ichlosigkeit und Übernahme sozialer Verantwortung.
Da ist es wohltuend, das gänzlich unaufdringliche Buch des ebenso zugewandten wie kenntnisreichen buddhistischen Lehrers und Schriftstellers Cuong Lu in die Hand zu bekommen. In der Hochphase des Krieges in Vietnam geboren und 1979 mit seiner Familie in die Niederlande geflüchtet, begann er dort, nach Studium und Klosteraufenthalt als buddhistischer Gefängniskaplan zu arbeiten. „Buddha hinter Gittern“ ist ein fesselnder Rückblick auf diese Arbeit – und zugleich ein kluger Leitfaden für die Leser und Leserinnen mit Interesse an einem unaufgeregten Buddhismus ohne Überlegenheitspathos.
Das Vorwort von Joan Halifax ist erwartbar professionell, sodass man es getrost auch überspringen darf. Doch dann folgen eine einordnende Einführung, in der Cuong Lu sein Leben skizziert, gefolgt von 52 kurzen Kapiteln über die Insassen, über Mord, Totschlag, Verzweiflung, aber auch über Meditation, Seelsorge und kleine Erleuchtungen. Man mag gar nicht aufhören, weiterzulesen.
Das sollte man aber. Man sollte sich Zeit nehmen, den Lesefluss unterbrechen, auch wenn man durch die sprachliche Klarheit (bewahrt durch eine sorgfältige Übersetzung) stark dazu angehalten wird. Denn jedes der Kapitel ist eher ein Koan und wie ein solches darauf angelegt, dass man, wenn man darauf herumkaut, schließlich den eigenen Denkknast aufzusprengen vermag: „Für einen Häftling ist es schwer, einzusehen, dass er nicht nur in seine Gefängniszelle eingeschlossen ist, sondern noch viel mehr dadurch, dass er zuallererst die Freiheit nicht als eine Geisteshaltung versteht.“ Ein wuchtiger Satz, gleich im ersten Kapitel, der dazu führen könnte, dass die Leserin oder der Leser stockt und irritiert die umgebenden Ikea-Möbel mustert. Schlagartig ist so nicht nur mehr von Derek die Rede, dem Häftling, der sich – wie eben manch andere oder anderer jenseits von Gefängnismauern ¬– machtlos fühlt in einer abgeschlossenen Welt.
Beeindruckend ist auch die Geschichte von Hans, der erfolgreicher Geschäftsmann war. Eines Abends dann kommt er nach Hause und schlägt scheinbar grundlos so lange auf seine Freundin ein, bis sie stirbt. Bei seiner ersten Begegnung mit Cuong Lu ist er dennoch fest überzeugt und auch stolz darauf, in seinem Leben nie wütend gewesen zu sein. Lus inhaltlich ebenso klare, eindeutige wie menschlich tief einfühlsame Antwort ist der Beginn für Hans, unterstützt durch die nun regelmäßige Meditation, mit seiner „Wut in Kontakt [zu] kommen“, wie er es selbst beschreibt. Ein tiefer Moment, der als Sprungbrett einen für den Rezensenten zentralen Satz des Buches vorbereitet: „Wir glauben, Leute im Gefängnis seien im Gegensatz zu uns ‚Kriminelle‘. Aber wir alle sind im Wesentlichen gleich.“ Das so klar zu lesen, verändert den Blick auf die Häftlinge, die Cuong Lu beschreibt: auf Fred, den ebenso ungläubigen wie unglücklichen Ex-Pfarrer, auf die Mitglieder von Rockerbanden, die Dealer, Zuhälter und Mörder. Und vielleicht gerade auch auf den Leser oder die Leserin.
Die Gespräche Lus mit seinen Meditations- und Gesprächspartnern und seine Betrachtungen darüber lassen sich nicht zuletzt im buddhistischen Kontext wie eine Aktualisierung der traditionellen Erzählung von Ahimsaka lesen, des „Gewaltfreien“, der zum Terroristen Angulimala wird (Angulimala heißt Fingerkranz – seine Halskette, gebildet aus den Knöcheln seiner Mordopfer). Vom Mythos in die Realität der Gegenwart.
Eine Realität, in der es weiterhin eine Tatsache bleibt, dass es Leiden gibt, worüber ja auch die edlen Wahrheiten in der Lehre des Buddha berichten. Doch anders als viele Lebenshilfebücher und geschäftstüchtige spirituelle Management- und Lifestyleberater sieht Cuong Lu weniger das Leiden an sich als Problem, das wäre nicht nur für einen Gefängniskaplan lebensfremd. „Das Leiden ist ein Problem, wenn wir es nicht sehen können. Können wir es sehen, dann kann die Berührung mit unserem Leiden befreiend sein.“ Ich möchte im Sinn meines Verständnisses des Buches ergänzen: auch die Berührung mit dem Leid anderer, für beide Seiten. Vehement wendet sich Cuong Lu gegen die Schamanen des positiven Denkens, die behaupten, dass das Leiden aus dem Leben verschwinden könne und müsse. Den Buddhismus sieht Lu nicht als „Selbsthilfeübung“, sondern als Einübung in das Nichtselbst, das Anatman der buddhistischen Lehre. Aus diesem Gewahrsein der Selbst- und Ichlosigkeit muss nicht mehr versucht werden, Leiden gewaltsam aus dem Alltag zu entfernen. Leiden entsteht und vergeht – und diese Einsicht befreit aus einem verzweifelten Kampf gegen die Realität des Lebens. Genau diese Veränderung dokumentiert der Verfasser dieses Werks, indem er Schritt für Schritt festhält, wie sehr die Arbeit aus seiner buddhistischen Überzeugung heraus die Gefangenen, zugleich aber auch ihn selbst verändert hat. Nicht im Sinne des notorischen Helfersyndroms, sondern als gemeinsame Entwicklung in gegenseitigem Respekt.
Bedauerlich ist, dass sich Cuong Lu überraschend und ohne Notwendigkeit zwischendurch einer allzu platten Wissenschaftsfeindlichkeit bedient, die eher in überholten theosophischen Romantizismen als in tatsächlicher Kenntnis gegenwärtiger wissenschaftstheoretischer Diskurse zu verorten ist. Der Satz „die Wissenschaft trennt die Menschen“ ist nicht nur angesichts des entscheidenden Beitrags der Klima- und Medizinforschung zum Leben aller fühlenden und auch nichtfühlenden Wesen schlicht falsch und auch im Buch unnötig. Denn Wissenschaft bringt (nicht nur) Menschen ebenso zusammen wie „Einsicht“ – hoffentlich, weil entscheidend für die anstehenden und zu lösenden Probleme.
Dennoch bleibt das Gesamturteil positiv: Cuong Lu zeigt in seinem Buch „Buddha hinter Gittern“, dass man in einer sozial unterstützenden Aufgabe sein kann, ohne dass sich die Beteiligten nur als Spieler von Rollen begegnen. Als Gefängnisseelsorger verfing er sich nicht in der idealisierten Aufgabe, einseitig „helfen“ zu können oder zu müssen. Er saß mit den Gefängnisinsassen zusammen, meditierte mit ihnen und tauschte sich im Gespräch aktiv mit ihnen aus. Er nahm von der Gesellschaft weggesperrte Menschen ernst, behandelte sie respektvoll und nicht nur als genetisch oder durch ihre Sozialisation determinierte Personen mit manchmal durchaus erschreckender Vergangenheit. Er beschönigt das nicht, konfrontiert diese Menschen mit den begangenen Verbrechen, um ihnen gerade so zu helfen. Denn „Glück taucht auf, wenn wir [...] Leiden spüren: es zu leugnen verhärtet das Leiden (und uns)“. Was für ein schöner Satz – da braucht es kaum noch die Empfehlung, dieses Buch zu lesen.
Rezensiert von Josef M. Huber
Cuong Lu
Buddha hinter Gittern – das Tor zur Freiheit
Edition Spuren 2020
168 Seiten
Print 19,00 €
Weitere Rezensionen finden Sie hier.