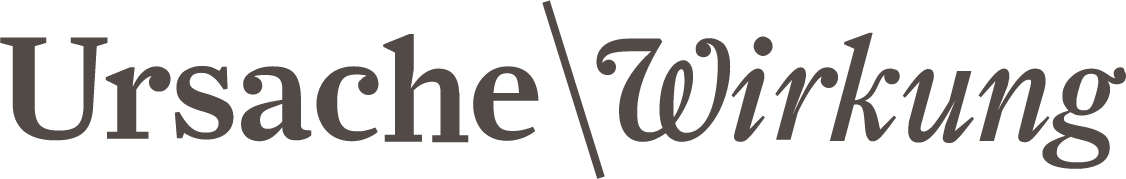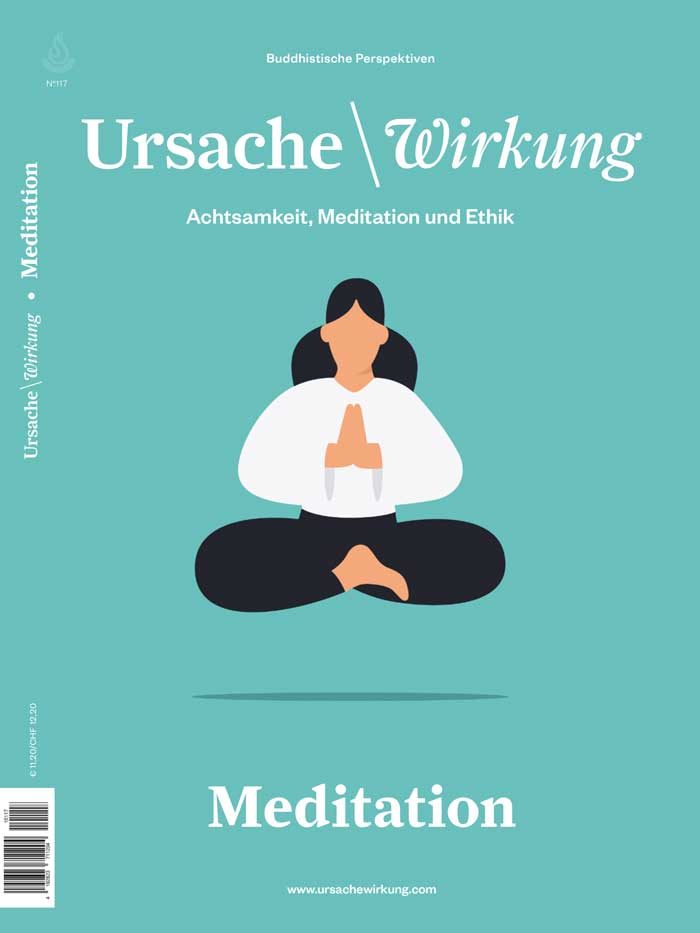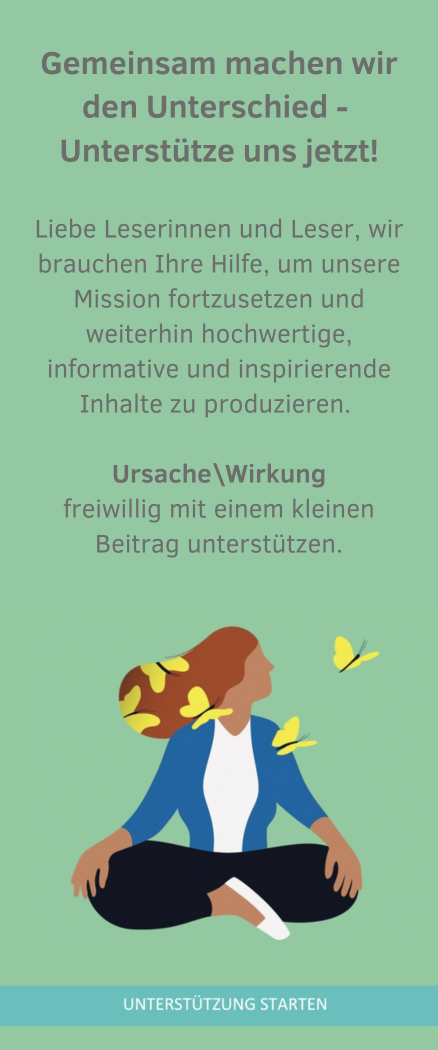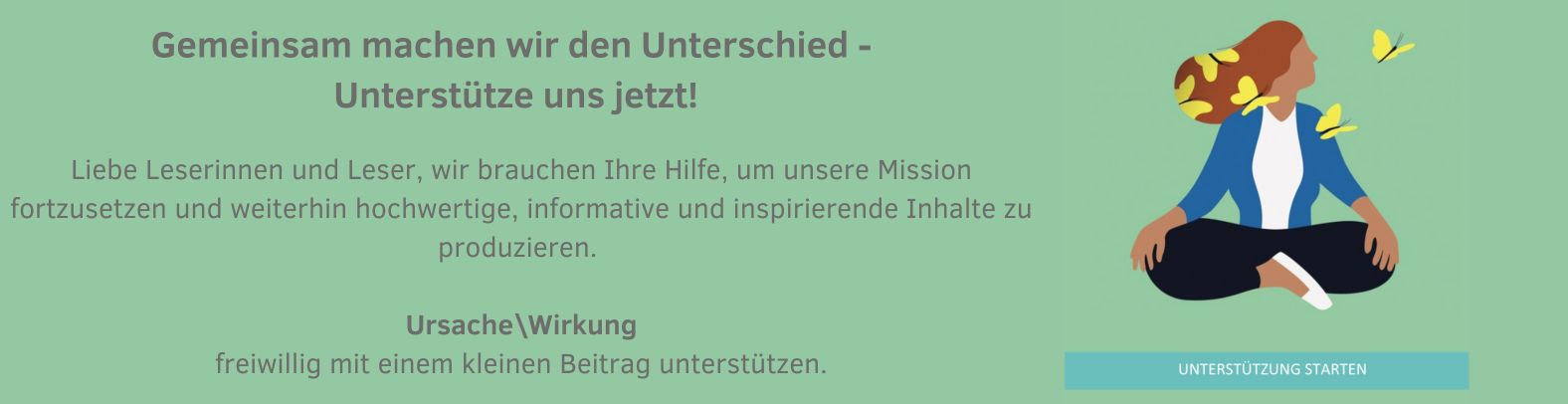Über den Umgang mit psychischen Stressreaktionen bei Meditation und Achtsamkeitsübungen. Dr. Matthias Hammer ist Psychologe und Verhaltenstherapeut.
Er unterrichtet Meditation und achtsamkeitsorientierte Methoden. Matthias Hammer ist in der Fortbildung für Meditations- und Achtsamkeitslehrende tätig. Hier bietet er unter anderem Kurse zum Thema „Notfallkompetenz für Meditations- und AchtsamkeitstrainerInnen“ an. Laut Kursbeschreibung geht es dabei um den „Umgang mit psychischen Stressreaktionen und Problemen von Kursteilnehmenden“. Weiter heißt es dort: „Panikattacken, Ängste und psychische Stressreaktionen während des Meditations- und Achtsamkeitstrainings können nicht nur unsere KursteilnehmerInnen vor besondere Herausforderungen stellen, sondern auch uns Kursleitende. Wie wir solche belastenden Situationen richtig erkennen und mit ihnen umgehen können, und wie wir unsere TeilnehmerInnen aber auch uns selbst am besten schützen können, erfährst Du in diesem Online-Workshop“.
Hortz: In der Regel werden die positiven Effekte von Meditation und Achtsamkeitsübungen betont. Sie helfen etwa bei Burn-out, bei Depressionen oder Angststörungen. Aber Meditation und Achtsamkeitsübungen können ebenso Auslöser von psychischen Problemen sein. Wie sind Sie auf diese Thematik aufmerksam geworden?
Hammer: Es gibt für mich zwei Zugänge. Der eine ist der fachliche Zugang. Ich arbeite mit Menschen, die psychische Probleme haben oder mit Stressproblematiken zu mir kommen. Dann schauen wir, welche Methode kann helfen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn im Einsatz von Achtsamkeitsmethoden haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auch zu Schwierigkeiten kommen kann. Menschen, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen, kennen das: Der Umgang mit Gedanken und Gefühlen, die bei Achtsamkeitsübungen auftauchen, ist nicht immer einfach. Manchmal verliert man die Kontrolle über die eigenen Gefühle. Dies muss man als Lehrender immer im Blick haben. Der zweite Zugang ist ein persönlicher: Ich habe 1995 mein erstes Sesshin, eine Zeit intensiver Zen-Meditation, absolviert. Das war für mich einerseits eine wichtige, aber andererseits ebenso eine belastende und anstrengende Erfahrung.
War diese Anstrengung vor allem physischer Natur? In einigen Zen-Schulen wird großen Wert auf die korrekte Körperhaltung gelegt. Man soll sich möglichst nicht bewegen. Was hart sein kann. Oder war es für Sie eher psychisch anstrengend?
Beides, auch psychisch. Ich war es nicht gewohnt, solange still zu sitzen und nicht irgendwas zu machen, meinen Geist nicht mit irgendwas zu beschäftigen. Das hat mich verunsichert und gestresst. Viele Menschen fühlen sich mit solchen Erfahrungen allein gelassen. Das höre ich oft von meinen Klienten. Die kommen von einem Achtsamkeits- oder Meditationsseminar zurück und denken: „Was ist mir da jetzt widerfahren?“ Man muss mit seinen Gedanken und Gefühlen einen guten Umgang finden und ein Verständnis für sie entwickeln. Es ist wichtig, über die Erfahrung reden zu können.
Sie würden in jedem Fall empfehlen, dass Lehrende Meditation und Achtsamkeit nicht nur technisch anleiten? Sie sollten ebenso eine Art Seelsorgefunktion übernehmen, mit den Teilnehmenden aktiv ins Gespräch gehen?
Unbedingt! Es ist notwendig, dass ein Meditations- oder Achtsamkeitslehrender sich über seine Rolle klar ist. Er leitet Übungen an und hilft, die Erfahrungen zu reflektieren. Er sollte sich sowohl seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Teilnehmenden bewusst sein als auch seiner eigenen Grenzen. Ein Meditations- oder Achtsamkeitslehrender ist kein Psychotherapeut.
Was bedeutet das genau?
Vielleicht merkt ein Kursleiter, ‚hoppla, da braucht jemand Unterstützung‘, eventuell auch im Alltag. Es gibt Hinweise auf eine psychisch tiefer gehende Problematik oder Störung. Dann sollte der Kursleiter dies dem Teilnehmenden sagen und ihm empfehlen, Hilfe zu suchen.
Also, als Lehrender Betroffene nicht allein lassen, aber ebenso erkennen, wann die eigene Kompetenz endet und dann gegebenenfalls an professionell Helfende vermitteln?
Ganz genau. Dafür muss einem als Lehrender die eigene Rolle klar sein. Man arbeitet mit Achtsamkeit – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Man sollte psychische Instabilität erkennen und Überforderung. Dann sollten zunächst einmal die Übungen individuell angepasst werden. Es ist von Bedeutung, einen Blick dafür zu entwickeln, was der jeweilige Teilnehmer in der Situation braucht. Es geht immer um Fürsorge.

Foto © privat
Verstehe. Dies setzt eine gewisse Kompetenz des Lehrenden über die eigentliche Vermittlung von Achtsamkeits- und Meditationstechniken hinaus voraus. Fordern Sie, dass jeder Meditations- und Achtsamkeitslehrende sich ein psychologisches Grundwissen aneignet?
Im Prinzip schon. Ein Teil des Wissens entsteht bereits durch Selbsterfahrung. Dass man sein eigenes inneres Erleben kennenlernt und der eigene Umgang mit Gedanken, Gefühlen, mit sich und anderen wahrgenommen wird, ist zunächst mal die zentrale Anforderung an einen guten Lehrenden. Das Nächste ist die Sensibilität dafür, ab wann es kritisch wird. Dann das Wissen, wie man mit kritischen Situationen umgehen kann.
Wie häufig muss man mit problematischen Reaktionen rechnen? Angenommen, ein Lehrender führt alle paar Wochen einen Kurs mit durchschnittlich zwanzig Leuten durch. Aufs Jahr gesehen sind das möglicherweise hundert Menschen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von hundert Teilnehmenden einer in eine problematische Situation gerät, oder zwei?
Mir sind dazu keine Studien bekannt. Man muss einfach sagen, dass Achtsamkeit in den letzten Jahren einen großen Boom erfahren hat. In jeder Illustrierten ist davon die Rede. In jeder Volkshochschule werden Kurse eingerichtet. Man wird überall mit Achtsamkeit konfrontiert. Das bedeutet, viele Menschen, die psychische Probleme haben, landen automatisch in den Kursen und Seminaren, weil sie populär sind. Hinzu kommt, dass sich in den letzten zwanzig bis 25 Jahren psychische Probleme in den Bereichen Angst und Depression verdreifacht haben. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass man als Lehrender irgendwann mit der Thematik konfrontiert wird.
Welche problematischen Reaktionen werden während Mediations- und Achtsamkeitstrainings am häufigsten beobachtet?
Vor allem die Anfangsphase ist sensibel. Man erhält von außen wenig Reize und begegnet daraufhin schwierigen Gedanken und Gefühlen. Wenn man vorher kaum Kontakt zu seinem inneren Erleben hatte, können Ängste vor Kontrollverlust entstehen. An dieser Stelle ist es wichtig, zu unterscheiden, ab wann eine problematische Situation im Rahmen ist – manches gehört einfach dazu – und ab wann eine Grenze zu einer Krise überschritten wird.
Ja, ein anfängliches Unwohlsein ist noch völlig normal.
Richtig. Brenzlich wird es erst, wenn psychische Probleme hinzukommen, etwa Folgestörungen von Traumata. Menschen werden dann mit Erinnerungen an schwierige Erlebnisse konfrontiert. In der Psychologie nennen wir dies Intrusion. Oder es kommt zu dissoziativen Zuständen. Eine Abspaltung vom eigenen Erleben, weil die aktuelle Situation unangenehm ist oder sogar unerträglich wird.
Kürzlich habe ich erlebt, dass jemand in einem Seminar ständig so halb weggetreten war. Dieses dissoziative Erleben kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand in der Vergangenheit traumatische Erfahrungen hat und jetzt Achtsamkeitsübungen nur dissoziativ durchstehen kann. Das ist überhaupt nicht gut. Wir sprachen daraufhin miteinander und einigten uns darauf, dass er eher aktivere Übungen macht, statt die stillen Formen. Das hat die Person stabilisiert. Er hatte auch therapeutische Unterstützung außerhalb des Kurses.
In einem anderen Kurs ist einmal ein Teilnehmer manisch geworden. Das war beunruhigend. Dies früh zu erkennen, war für ihn sehr wichtig. Er brach das Seminar auf meinen Rat hin ab. Eher selten sind psychotische Symptome, wenn jemand zum Beispiel Stimmen hört. In diesem Fall sind auch einfache Achtsamkeitsübungen überfordernd. Es ist dann wichtig, eine adäquate Behandlung zu erhalten.

Wie sieht eine konkrete Handlungsanweisung für einen Lehrenden aus? Er merkt, bei einem Teilnehmer gibt es Hinweise auf eine Dissoziation, oder da geht es jemandem schlecht.
Am wichtigsten ist es, mit dem Betroffenen in einen Dialog zu kommen. Der Lehrende sollte versuchen, das einzuordnen. Jemand, der dissoziiert, kennt das häufig bereits aus anderen Situationen. Ist die aktuelle Übung überfordernd, weckt sie die Dissoziation, kann die Übung angepasst werden. Was immer stabilisierend wirkt, ist Achtsamkeit der Sinne: achtsames Gehen, spüren, sich wieder im Hier und Jetzt verankern. Das erfordert keine so hohe Aufmerksamkeitsleistung wie das stille Sitzen.
Wenn die Situation wirklich schwierig ist, hilft nur ein Abbruch. Der Lehrende muss sich dann die Frage stellen, ob es ratsam ist, dass der Betroffene externe Hilfe in Anspruch nimmt: Gibt es einen anderen Ort, wo er Hilfe finden kann, ein regionales Hilfesystem oder eine Anlaufstelle, die telefonisch erste Hilfe leistet? Oder ist der Betroffene möglicherweise bereits in psychotherapeutischer Behandlung? Kann er seine Therapeutin oder seinen Therapeuten anrufen?
Es ist also angeraten, dass sich der Lehrende vor Kursbeginn erkundigt, ob es vor Ort Hilfsangebote gibt, zu denen man jemanden gegebenenfalls vermitteln kann?
Ja, das wäre sicher ideal.
Wir haben bisher vor allem die Seite des Lehrenden beleuchtet. Worauf sollte ein Teilnehmer achten? Dass man mit Ängsten konfrontiert wird, weil die Situation ungewohnt ist, ist soweit normal, wie wir gesehen haben. Wo aber verläuft die Grenze? Wann ist es ratsam, einen Meditations- oder Achtsamkeitskurs von sich aus besser abzubrechen? Können Sie dazu Hinweise geben?
Zunächst sollte man mit dem Lehrenden über das Erleben sprechen. Meist entsteht dann wieder Sicherheit. Es wird sich in der Regel wieder ein größeres Kontrollgefühl einstellen. Ein Empfinden, „ja, ich kann damit umgehen. Diese Methode, die ich da jetzt lerne, ist etwas für mich, sie ist hilfreich und nützlich“. Wenn man aber eher den Eindruck hat, dass sich die Irritation steigert, man etwa jedes Mal wieder mehr ins Grübeln kommt oder noch mehr Angstgefühle aufsteigen, würde ich eher dazu raten, aufzuhören. Ich sehe oft, dass Menschen mehrere Anläufe brauchen. Sie probieren verschiedene Übungen aus und entdecken dann irgendwann etwas, das für sie passt. Das kann eine bestimmte Methodik sein, ein besonderer Lehrer, eine besondere Lehrerin. Das ist der richtige Weg, denke ich.
Manchmal haben Teilnehmende zu hohe Erwartungen, Leistungsansprüche, Perfektionismus, denen sie nicht gerecht werden können. Abzubrechen hat aber nichts mit Scheitern zu tun, sondern mit Selbstfürsorge.
Manche Phänomene, denen man in der Meditation begegnet, sind irritierend, ohne kritisch zu sein. Das muss man aber vorher wissen, sonst ängstigt man sich, was da passiert. Aus meiner eigenen Mediationspraxis kenne ich das, dass man auch mal mit einem Lachanfall konfrontiert wird oder mit Tränen.
Richtig. Wenn man weiß, dass das vorkommt, dass Körper und Geist so reagieren können, dann nimmt das das Bedrohliche aus der Situation. Hier ist ein Meditations- oder Achtsamkeitslehrender wie ein Bergführer, der hilft, die eigene innere Landschaft zu erkunden. Man wird mit Erfahrungen konfrontiert, die nicht alltäglich sind. Aber sie sind Teil des Übungswegs. Solche Erfahrungen haben nichts mit einer Störung zu tun. Man sollte darüber reden, um sie einordnen zu können. Psychische Themen hingegen treten in einer anderen Intensität auf. Da funktioniert der eigene innere Beobachter nicht mehr. Man selbst bekommt dann oft gar nicht mehr mit, dass etwas entgleist. In dieser Situation ist ein Lehrender als fürsorglicher, kompetenter Ansprechpartner gefragt.
Vielen Dank für das gehaltvolle Gespräch, Herr Hammer.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 117: „Meditation"
Bild Teaser & Header © Pixabay