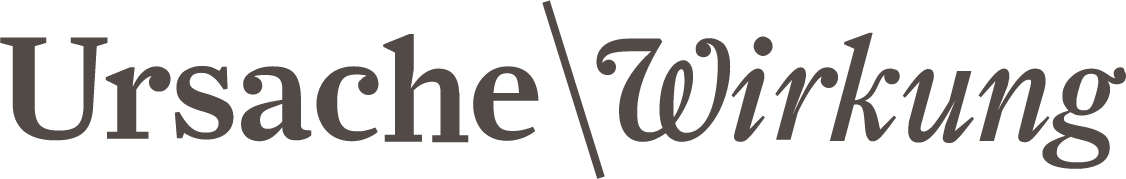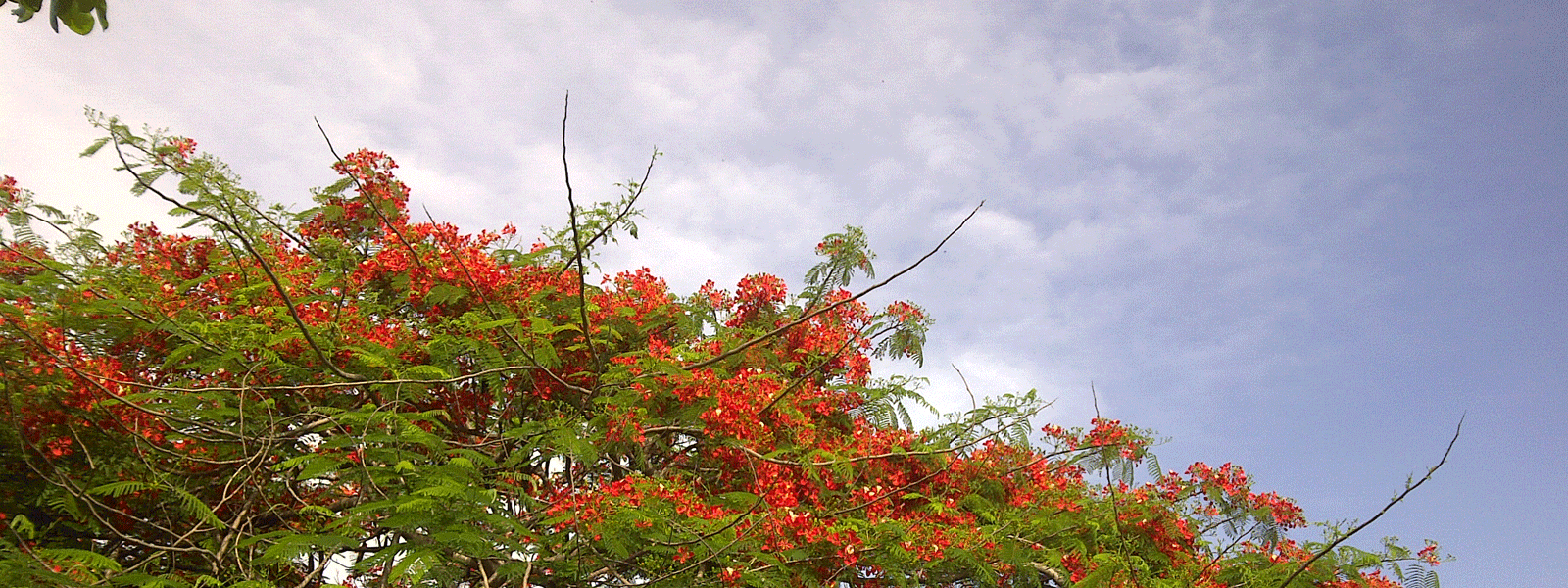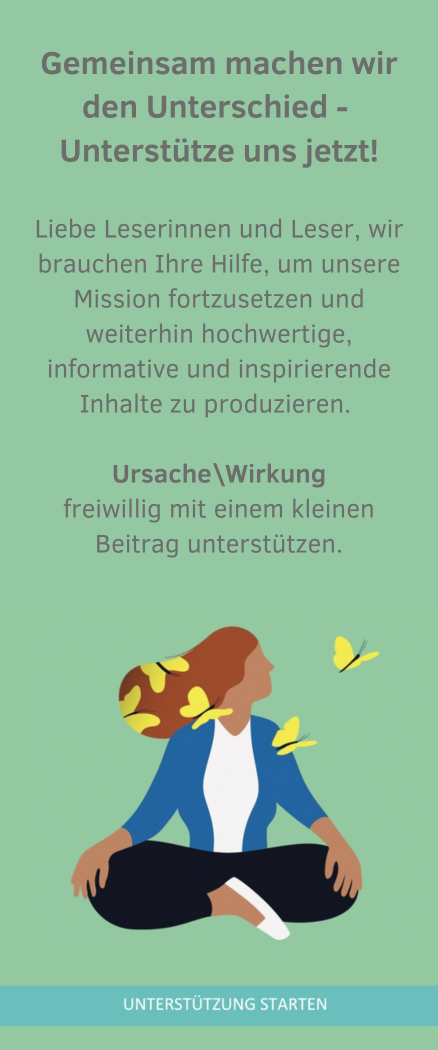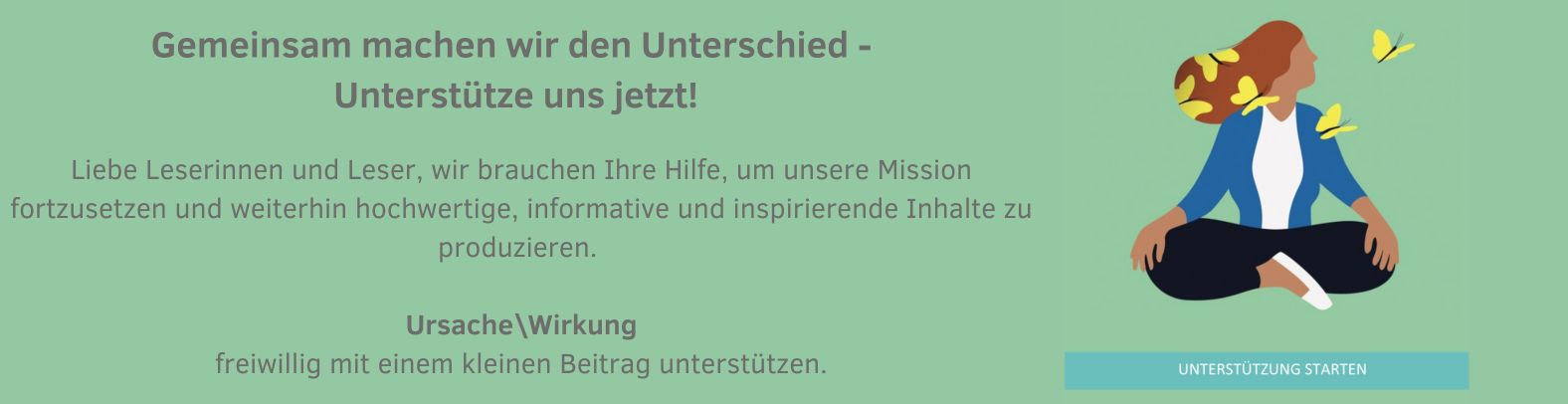Nach der kleinen Mückenattacke von letzter Woche kam noch eine größere, die mich tatsächlich davon abgebracht hat, zum See zu fahren. Aber grundsätzlich mag ich Tiere – auch wenn ich das jahrelang nicht wusste.
Als die Kinder klein waren, hörte ich oft die Frage, warum ich keine Tiere möge. Und meine Standardreaktion lautete: „Weil sie nicht antworten.“ Vermutlich hätte ich vor meiner Zeit mit den Kindern die gleiche Antwort gegeben, hätte man mich gefragt, warum ich keine Kinder mochte. Doch das hat sich ja dann geändert, und meine Welt wurde eine ganz andere. Kürzlich hat mich die Freundin meines Jüngsten gefragt, ob ich es sinngemäß bedaure, dieses Leben gewählt zu haben. Es konnte nur ein „Nein“ folgen, denn alles, was ich heute in meinem glücklichen Zustand bin, hat mit dieser Wahl zu tun. Auch dass sich der Kreis der jungen Menschen nach wie vor erweitert, weil die Kinder ihre Liebsten mitbringen und durchwegs eine Wahl getroffen haben, die ich nachvollziehen kann. Dass das wichtig ist, wurde mir vor Jahren durch die älteste Freundin meiner Mutter bewusst, die einmal sagte: „Man mag den Partner der Tochter, wenn er einem selbst gefällt.“ Was natürlich erklärt, warum es immer zu Reibereien zwischen meiner Mutter und mir kam – nur selten hätte sie sich den Mann ausgesucht, den ich zum jeweiligen Zeitpunkt gerade gewählt hatte. Andererseits: Ihre Wahl war nach einzelnen Testversuchen jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei – am ehesten noch das Gelbe von Tausendjährigen Eiern. Die sind zwar eine Delikatesse, aber das sind Stierhoden auch. Und ich muss wirklich nicht alles mögen.
Mein Verhältnis zu Tieren war lange ein wirklich schwieriges. Es begann mit einer erfrorenen Schildkröte, zog sich über eine falsch ernährte und deshalb verhungerte Wüstenspringmaus bis hin zu einer erstickten Streunerkatze. Doch irgendwann fiel mir auf, dass Tiere mich suchten – wie Kinder. Und da begann ich zu akzeptieren, dass sie in mir irgendetwas sahen, was ich selbst nicht wahrnehmen konnte. Meine jetzige Katze, die mir ja nicht gehört, aber trotzdem nicht von mir ablassen will, ist jetzt schon fast fünf Jahre in meinem Alltag, und selbst wenn sie eigentlich als Zimmerkatze gepolt war, schlägt sie sich in der freien Wildbahn meines Gartens tapfer. Wenn eine rote Katze unter dem Tor durchschlüpft, wird sie extrem aggressiv, und das ist deshalb putzig, weil es dem Eindringling herzlich wurscht ist, dass die Kleine faucht und grummelt. Was nicht passiert, wenn der Haus-und Hof-Igel durch den Garten kruschelt. Den schaut sie sich in aller Ruhe an und toleriert es sogar, wenn er von ihrem Teller frisst. Nicht, dass der Gute zu wenig Futter finden würde – ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Schnecken ich heuer schon von meinen Dahlienschößlingen, Malven und Astern heruntergeklaubt habe! Und offenbar haben sich auch Tigerschnecken angesiedelt, die eine Freundin zwar als positiv bewertet, weil sie die Eier der anderen Nacktschnecken frisst, doch auch vor meinen Pflanzen nicht Halt macht. Ein typisches Beispiel von „Nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes daherkommt“ - trotzdem: bitte nicht in meinem Garten, auch nichts Getigertes. Kleopatras Tiger reichen mir.

Wie schon öfters an dieser Stelle erwähnt, finde ich das Zusammensein mit meiner Katze meistens ziemlich entspannend. Und wenn sie mir während des Meditierens auf dem Bauch liegt und so dreinschaut, als würde sie jede Silbe des Mantras verstehen, gelingt mir das innere Lächeln besonders gut. Diese Woche allerdings war sie unruhig. Und den Grund dafür merkte ich erst dann, als etwas auf meiner Nase kitzelte. Als ich das Etwas verscheuchte, merkte ich, dass die Katze ihren Blick ruckartig nach links warf. Und da war ich dann doch neugierig, was mich irritiert und aus dem Mantra geworfen hatte: eine kleine grüne Heuschrecke. Sie machte ein paar Sprünge und verschwand dann hinter dem Sofa – vermutlich wird sie dort ihr Ende finden, denn selbst der Saugroboter findet dort von alleine nicht mehr heraus. Der Vater meines kleinen Nachbarn würde sagen: „Wieder ein selbstmordwilliges Tier, dass dich gefunden hat.“ Ha, ha.
Ich höre, dass Heuschrecken ein Symbol für eine zerstörerische Kraft sein sollen, die aus dem „Rauch“ oder Einfluss des Schlundes hervorkommt, um die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben, zu stechen und quälen. In diesem Sinne: Gott! Das Ding ist noch nicht einmal so groß wie ein Glied meines kleinen Fingers. Doch da ja alles nur eine Frage der Interpretation, wahlweise des Glaubens ist, finde ich eine andere Symbolik, nämlich bei den Chinesen. Für sie ist die Heuschrecke eine für Glück und Wohlstand, weil man die viermalige Häutung als ein Symbol der Seele ansah. Das klingt doch sehr viel besser und optimistischer, finde ich. Da ich meinen Mückenstich auf der Stirn wahrlich nicht als Siegel Gottes betrachten möchte, gefällt mir die Idee viel besser, dass meine Seele sich häutet. Und gerade in diesem Jahr, in dem so vieles anderes ist als früher, ist das wohl auch notwendig und hochwillkommen.
Vielleicht krieche ich doch noch unter das Sofa und versuche, die Heuschrecke zu retten. Wenn die Katze sie nicht schon gefressen hat – Heuschrecken sollen ja auch Delikatessen sein. Nicht nur für Stubentiger. Doch es gibt offenbar ethische Bedenken dagegen bezüglich aufwendiger Zucht und langer Transportwege. Was man alles lernt, wenn einem ein Grashüpfer auf die Nase springt! Ob ich beim Meditieren das nächste Mal den Mund offen lasse, damit einer reinspringen kann, überlege ich mir trotzdem noch.
Weitere Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.