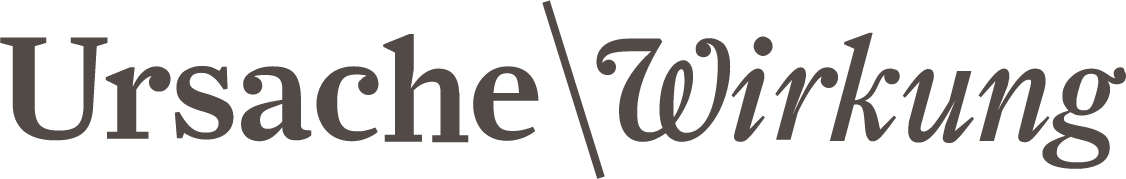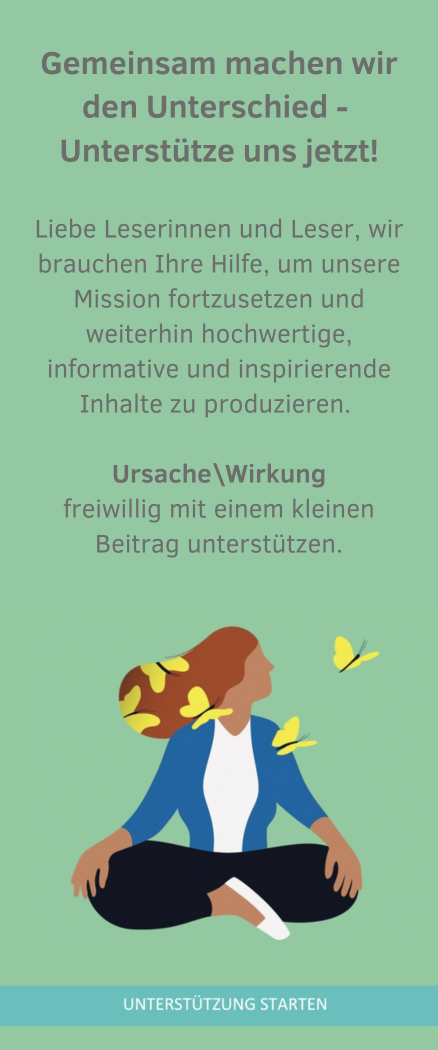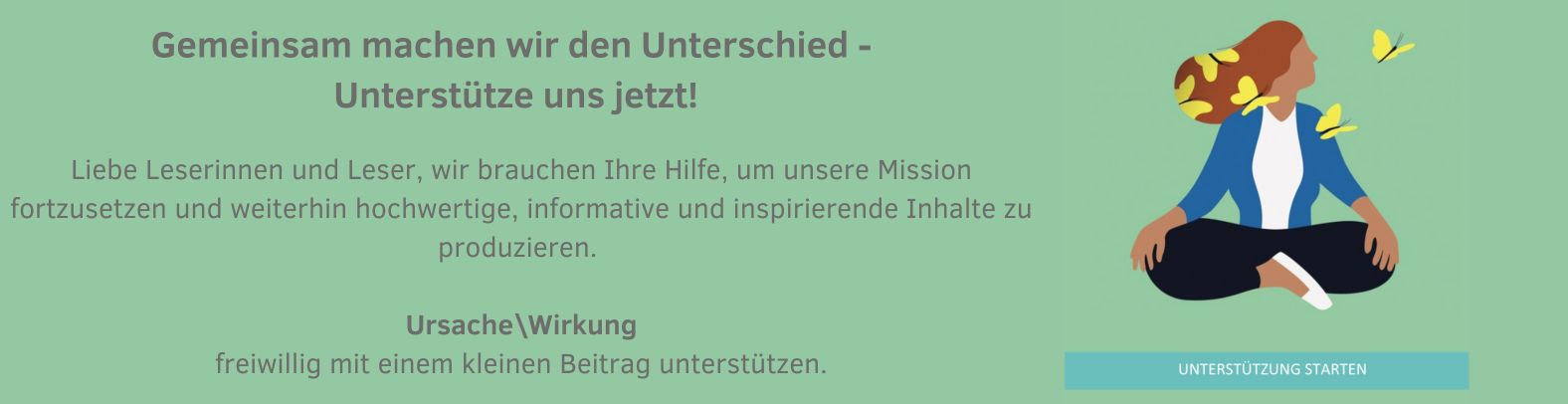Wie entsteht die Angst vor dem Fremden und wie können wir damit konstruktiv umgehen und einander helfen, das Beste aus dieser Herausforderung zu machen?
Schon immer war Europa eine Region der Begegnung mit fremden Menschen. Viele von uns leben nicht mehr dort, wo sie geboren wurden, und waren irgendwann Fremde an einem neuen Ort. Menschen aus Europa reisen gerne ins ‚Ausland‘ und viele von uns lieben Musik und Speisen aus anderen Ländern. Wir sind gerne ‚Ausländer auf Zeit‘. Solange wir selbst darüber bestimmen können, wie viel Fremdes wir uns zumuten wollen, sind wir damit einverstanden, auf Reisen und im eigenen Land. Wir haben uns auch an ‚Gastarbeiter‘ gewöhnt, die seit den 1960er Jahren hier arbeiten, und an ‚Ausländer‘, die als Touristen das schöne alte Europa besuchen. Inzwischen leben in manchen großen Städten zwanzig, dreißig Prozent Menschen mit ‚Migrationshintergrund‘, sie kommen aus Europa und anderen Erdteilen. Daran haben sich die meisten gewöhnt, denn wir können weitgehend selbst entscheiden, wie viel Kontakt wir haben wollen.
Vor allem die große Anzahl der Fremden weckt Ängste.
Seit dem Spätsommer 2015 kommen zu den vielen ‚Fremden‘, die schon lange bei uns leben, rund eine Million Flüchtlinge aus dem Nahen und Ferneren Osten sowie aus Afrika. Sie sind auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung und viele kommen aus Regionen, wo ein normales Leben nicht möglich ist. Alle Menschen brauchen ein Zuhause, in dem sie sich sicher fühlen, sie wollen arbeiten und feiern, Kinder großziehen, Freundschaften pflegen und ihre Kultur genießen. Sie kommen nach Europa, in diesen Hort des Wohlstands und Friedens. Das war absehbar, aber da wir Menschen vor allem ‚gierig, ängstlich und bequem‘ sind, kümmern wir uns um vieles erst, wenn es uns unter den Nägeln brennt.
Normalerweise gibt es zwei Reaktionen auf Fremdes. Es fasziniert oder weckt Angst. Wir reisen in fremde Länder, gehen auf fremde Menschen zu und lernen etwas Neues über uns und die Welt. Wenn wir uns vor fremden Menschen fürchten, gehen wir weg, innerlich und oft auch äußerlich. Manchmal erkennen wir unsere Furcht nicht, sondern spüren nur Ärger oder Unsicherheit, Verachtung oder Abwehr.
Die Art, wie wir auf fremde Menschen reagieren, hat sehr viel mit dem eigenen Selbstbild und der Verwurzelung in eigenen Werten zu tun. Je unsicherer wir uns unserer selbst sind, desto mehr Angst haben wir vor Fremden.
Wenn wir uns vor fremden Menschen fürchten, gehen wir weg, innerlich und oft auch äußerlich.
Ich möchte ein Modell vorstellen, das mir in den letzten zwanzig Jahren sehr geholfen hat, mit Unterschieden aller Art umzugehen. Es ist inspiriert vom Modell der Zuflucht im Buddhismus. ‚Zuflucht zu Buddha‘ steht für die Vision eines vollständigen Menschseins, ‚Zuflucht zu Dharma‘ für die Relativierung von Konzepten und die Einsicht in die tiefe Verbundenheit mit anderen und ‚Zuflucht zu Sangha‘ steht für inspirierende vertikale und horizontale Beziehungen zu anderen. Ich habe es in der Reflexion der nicht immer einfachen Beziehungen zwischen Frauen und Männern entwickelt. Meine These ist: Wenn wir – Frauen und Männer – uns als unterschiedlich und gleichwertig wahrnehmen und anerkennen können, haben wir den Schlüssel in der Hand, mit allen Arten von Unterschieden konstruktiv umzugehen. Aus der Sicht von Frauen bedeutet das: Frauen brauchen erstens die Einsicht, dass Geschlechterrollen bedingt entstehen und sich immer wieder verändern, und zweitens brauchen sie horizontale, vertikale und transzendentale Beziehungen zum eigenen Geschlecht. Aus diesen drei Arten von Beziehungen zum eigenen Geschlecht – Beziehungen auf Augenhöhe zu anderen Frauen, Frauen als Vorbilder und Lehrerinnen und schließlich ein weibliches Symbol der Transzendenz – entsteht das Maß an Selbstvertrauen und Weltvertrauen, das Beziehungen zum anderen Geschlecht fruchtbar werden lässt, horizontal, vertikal und transzendental: zu männlichen Freunden, Vorbildern und Lehrern und zu männlichen Bildern der Transzendenz. Auch Männer brauchen die Einsicht, dass Geschlechterrollen sich verändern können, und drei Arten von Beziehungen zum eigenen und zum anderen Geschlecht. Falls uns dieses Modell inspiriert, können wir schauen, welche Beziehungen da sind und welche fehlen, und uns über das freuen, was da ist, und uns um die Beziehungen kümmern, die fehlen.
Die Art, wie wir auf fremde Menschen reagieren, hat sehr viel mit dem eigenen Selbstbild und der Verwurzelung in eigenen Werten zu tun.
Dieses Modell können wir übertragen auf die Begegnung mit Menschen aus anderen sozialen Schichten, mit unterschiedlichen politischen Vorstellungen und aus anderen Kulturen. Wir brauchen eine tiefe Einsicht in die Relativität unseres Menschenbildes und sechs Arten der Beziehung, drei zum Eigenen und drei zum Fremden. Die Menschen, die als Fremde zu uns kommen, brauchen das auch, doch für sie scheint es noch schwieriger zu verwirklichen als für uns. Wir Menschen aus Europa müssen tief verstehen, dass unser neuzeitliches, modernes oder postmodernes Menschen-, Männer- und Frauenbild nicht das passende Modell für alle Menschen ist. In der Kulturphilosophie nennt man das ‚Einsicht in den eurozentrischen Blick‘. Wir können uns trotzdem am neuzeitlich europäischen Menschenbild der Aufklärung orientieren, wenn das zu uns passt.
 Allerdings müssen die AnhängerInnen des modernen Menschenbildes begreifen, dass nicht alle Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, in der gleichen Kulturzeit leben. Ich vermute, dass weit über die Hälfte der Menschen in Europa geistig und emotional vor dem Zeitalter der Aufklärung lebt. Sie sehen wenig Sinn darin, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, und fühlen sich wohl mit ihren Sitten und Bräuchen sowie den vormodernen Werten von Autorität und Loyalität gegenüber den eigenen Leuten. Sie scheinen sehr verunsichert durch die modernen Zeiten, die ihren bewährten Lebensstil durcheinanderbringen – und oft sogar verachten. Sie schätzen zwar die materiellen Vorteile der Globalisierung, nicht aber deren Auswirkungen auf ihren Lebensstil. Menschen verändern sich nur langsam und das verstehen vermutlich viele PolitikerInnen und humanistisch gesinnte Menschen nicht. Wenn man ‚die Sorgen der Menschen ernst nehmen‘ will, bedeutet das nicht, ihre Verachtung und wütenden Reaktionen zu rechtfertigen oder zu akzeptieren. Wir müssen allerdings dazu beitragen, dass ihr Bedürfnis nach vertrauten Umständen Raum findet, und dazu gehören einigermaßen stabile wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen und Beziehungen.
Allerdings müssen die AnhängerInnen des modernen Menschenbildes begreifen, dass nicht alle Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, in der gleichen Kulturzeit leben. Ich vermute, dass weit über die Hälfte der Menschen in Europa geistig und emotional vor dem Zeitalter der Aufklärung lebt. Sie sehen wenig Sinn darin, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, und fühlen sich wohl mit ihren Sitten und Bräuchen sowie den vormodernen Werten von Autorität und Loyalität gegenüber den eigenen Leuten. Sie scheinen sehr verunsichert durch die modernen Zeiten, die ihren bewährten Lebensstil durcheinanderbringen – und oft sogar verachten. Sie schätzen zwar die materiellen Vorteile der Globalisierung, nicht aber deren Auswirkungen auf ihren Lebensstil. Menschen verändern sich nur langsam und das verstehen vermutlich viele PolitikerInnen und humanistisch gesinnte Menschen nicht. Wenn man ‚die Sorgen der Menschen ernst nehmen‘ will, bedeutet das nicht, ihre Verachtung und wütenden Reaktionen zu rechtfertigen oder zu akzeptieren. Wir müssen allerdings dazu beitragen, dass ihr Bedürfnis nach vertrauten Umständen Raum findet, und dazu gehören einigermaßen stabile wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen und Beziehungen.
Wenn wir im Eigenen verwurzelt und getragen sind, finden wir auch den Mut und die Zuversicht, fremden Menschen zu begegnen.
Wir müssen erstens verstehen, dass es unterschiedliche kulturelle Selbstbilder gibt und diese sich auch verändern, selbst dann, wenn wir das nicht wollen. Damit wir damit gut umgehen können, brauchen wir zweitens sechs unterschiedliche Arten von Beziehungen, drei zum eigenen und drei zum fremden Kulturraum. Wir brauchen horizontale und vertikale Beziehungen zu Menschen, mit denen wir Werte teilen: Beziehungen auf Augenhöhe, mit Kontinuität und Verlässlichkeit, im Dorf und im Stadtviertel, in der Region und im Land. Und wir brauchen kulturelle Vorbilder, die uns das, was wir noch nicht können, vorleben. Dazu müssen sie nicht perfekt sein. Der überzogene Anspruch, dass PolitikerInnen alles wissen und keine Fehler machen sollten, scheint ein Wunschtraum von Menschen zu sein, die selbst keine Verantwortung für sich und ihre Gesellschaft übernehmen wollen und erwarten, dass Vater Staat und Mutter Sozialstaat sich um alles kümmern.
Wir brauchen Freundschaften und kollegiale Beziehungen und Vorbilder in unserem Gemeinwesen und Kulturraum, aber auch ein transzendentes oder transpersonales Bild für unsere Werte. Im christlichen Abendland war das lange das Christentum. Dieses Ideal ist wohl seit dem Dreißigjährigen Krieg, als sich die beiden großen christlichen Konfessionen im Namen Gottes zerfleischten, nachhaltig beschädigt. Seit der Aufklärung ist unser Ideal vermutlich das humanistische Menschenbild, dem zwar keine messbare Realität entspricht, das uns aber dennoch inspiriert. Es hat die Vision der Menschenrechte hervorgebracht, die im Prinzip für alle Menschen gelten sollten, aber heutzutage vor allem für die BürgerInnen des eigenen Staates reserviert sind und nicht so eindeutig für Flüchtlinge aus fremden Ländern gelten.
Wir brauchen nicht nur Beziehungen zum eigenen Kulturraum, sondern auch Begegnungen mit Menschen, die anders sind und anders denken als wir.
Wenn wir im Eigenen verwurzelt und getragen sind, finden wir auch den Mut und die Zuversicht, fremden Menschen zu begegnen. Wir brauchen das auch, wenn wir nicht in unseren eurozentrischen Ansichten versumpfen wollen. Die Menschen, die aus fremden Ländern und Kulturen zu uns nach Europa kommen, brauchen diese Verwurzelung im Eigenen genauso wie wir. Dann erst können sie sich einlassen auf die Begegnung mit der für sie fremden Kultur in Europa. Unser Beitrag für ein gutes Zusammenleben mit Fremden besteht auch darin, unsere eigenen Wurzeln zu stärken, und zwar nicht als Abgrenzung gegen die Fremden, sondern als Voraussetzung, um ihnen ohne Angst begegnen zu können. Wir können die Fremden dabei unterstützen, sich in kulturell einigermaßen homogenen Gruppen zu stabilisieren. Es scheint sinnvoll, die Fremden langsam an die auch für sie fremden Kulturen der anderen Flüchtlinge heranzuführen und sie nicht mit einem pauschalen Hinweis, sich gefälligst mit allen zu vertragen, zu überfordern. Das könnten auch nur wenige Menschen aus Europa. Sensibilität für die Verletzbarkeit der Flüchtlinge und für die Grenzen der Belastbarkeit nicht nur von uns, sondern auch von ihnen, ist sicherlich sehr hilfreich für alle Beteiligten.
Die Begegnung mit den Fremden ist nicht nur eine große Herausforderung, vielleicht sogar eine Zumutung, sondern auch eine große Chance für uns in Europa, und das nicht nur aus demografischen und wirtschaftlichen Gründen. Denn wir brauchen nicht nur Beziehungen zum eigenen Kulturraum, wie es uns die rechten Parteien suggerieren, sondern auch Begegnungen mit Menschen, die anders sind und anders denken als wir. Das war das Geheimnis der kreativen Kraft der Städte seit der Antike. In den Städten begegneten sich Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kulturen. Aus diesen Begegnungen entstand die Welt der griechischen Polis, das kosmopolitische Rom und das kosmopolitische Europa. Dieses war mit Sicherheit kulturell bunter, als sich das nationalistische Spießbürger vorstellen. Europa war kulturell, politisch und ökonomisch immer dann erfolgreich, wenn es sich auf die Begegnung mit dem Fremden einließ und sich davon inspirieren ließ.
Die Begegnung mit dem Fremden bietet zwar große Chancen, allerdings nur für die Menschen, die das auch wollen. Weil sie das wollen, haben sie auch die Kraft, Probleme als Herausforderungen zu sehen und kreativ zu verarbeiten. Wenn wir wenig verwurzelt sind im Eigenen und kaum eine positive Beziehung zu den Werten der christlichen Nächstenliebe und der humanistischen Aufklärung haben – um nur zwei der größten Inspirationsquellen Europas zu nennen –, macht uns die Begegnung mit fremden Menschen Angst und wir erleben sie als Zumutung. Um diese Ängste müssen sich auch die Menschen kümmern, die humanistische Werte hochhalten und Fremde gerne willkommen heißen.
Je mehr wir verstehen, dass alle Meinungen und Ansichten Vorstellungen sind, und je mehr wir die relative, bedingte und die tiefe Verbundenheit mit anderen erkennen, desto leichter fällt es uns, Menschen, die uns fremd sind, freundlich zu begegnen.
Europa war kulturell, politisch und ökonomisch immer dann erfolgreich, wenn es sich auf die Begegnung mit dem Fremden einließ und sich davon inspirieren ließ.
Dabei ist es zweitrangig, ob diese Werte religiös oder humanistisch formuliert werden. Wichtig ist, dass sie die Dimension von Vorlieben und Abneigungen, von fassbaren und spürbaren Unterschieden transzendieren und uns so die Kraft und den Mut und die Zuversicht schenken, dass wir mit allen Herausforderungen – mit Ängsten und Vorurteilen, mit Erwartungen und Befürchtungen – irgendwie und irgendwann konstruktiv umgehen können. Ein Hinweis aus den Bodhisattva-Lehren inspiriert mich übrigens ganz besonders: Wenn Bodhisattvas viel getan haben und müde sind, sollen sie sich ausruhen. Wer zum Wohle aller arbeiten will – zum eigenen und dem der anderen –, braucht einen relativ entspannten und wachen Herz-Geist. Regelmäßiges Innehalten, man kann es auch Meditation nennen, kann sehr hilfreich sein.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 95: „Keine Angst"
Sylvia Wetzel, Vertrauen. Finden, was uns wirklich trägt, Scorpio 2015.
Bild Teaser & Header © Unsplash