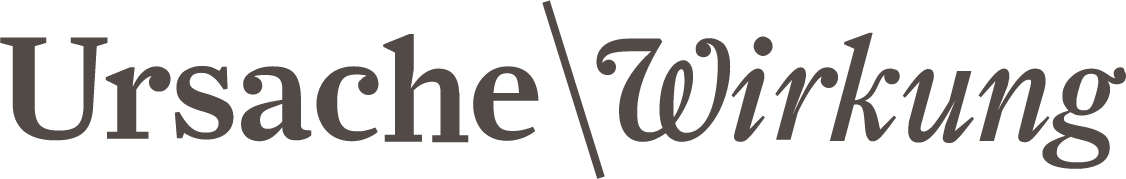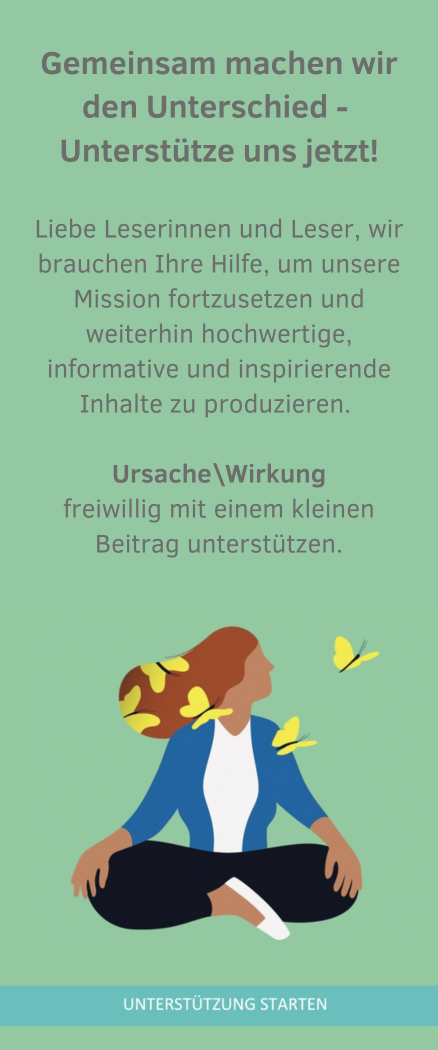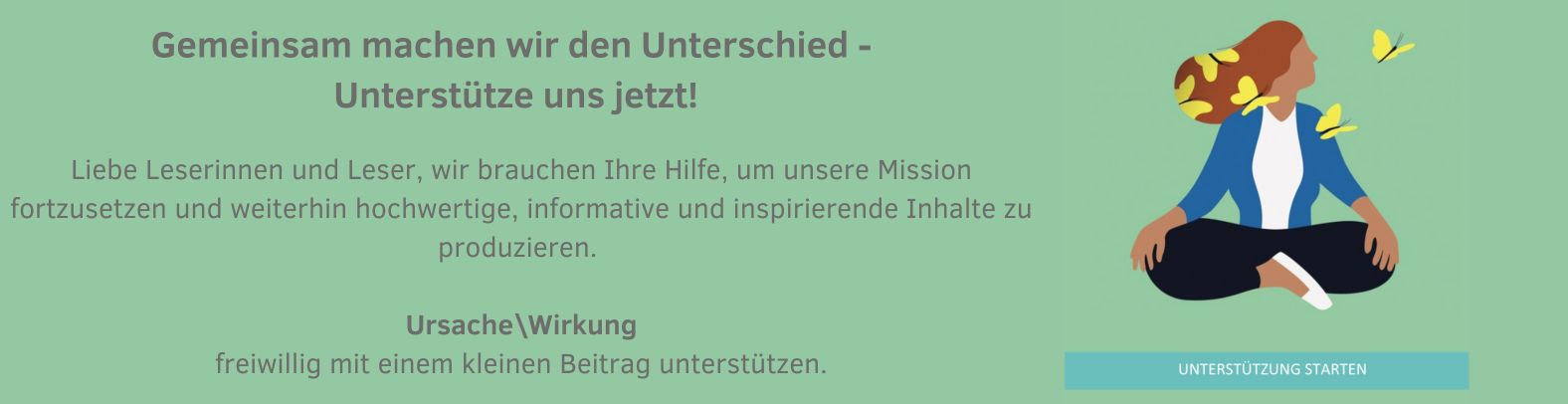Die Ruhe bewahren. Das Bild von sich selbst in der Welt bestimmt seit Jahrtausenden das Schicksal der Menschen – eine Suche nach Gelassenheit.
Gelassenheit gilt gemeinhin als eine Sekundärtugend. Als eine Charaktereigenschaft also, die das Leben zwar lebenswerter macht, aber nicht unbedingt ein Muss ist. Würde man den Sachverhalt mit dem Vokabular eines Autohändlers beschreiben wollen, dann wäre Gelassenheit nicht in der charakterlichen Grundausstattung enthalten, sondern Teil des Komfortpakets – vergleichbar mit einer Drei-Zonen-Klimaanlage oder der stufenlos regelbaren Sitzheizung.
Dass Besonnenheit Luxus ist, mag zwar anno dazumal gestimmt haben, als das Weltgeschehen ruhig dahingeplätschert ist, heutzutage jedoch wird die Fähigkeit, innere Balance zu halten, zusehends zu einer Conditio sine qua non. Denn die Zeiten sind unruhig und die Leben immer enger getaktet. Wirtschaftskrisen, Desinformationskampagnen in sozialen Netzwerken, Digitalisierung der Berufswelt, soziale Verteilungskämpfe, offensiv zur Schau gestellte Ignoranz und Rüstungswettläufe der Befindlichkeiten verursachen Stress und lösen einen Wunsch nach Ruhe aus.
Es ist ein harmlos klingender Wunsch mit weitreichenden Konsequenzen. Denn das Ruheversprechen wurde auf dem politischen Markt in ein Produkt verwandelt. Und die Bestanbieter dieses Produkts sind nicht mehr die altehrwürdigen Handelshäuser der politischen Mitte, sondern fliegende Händler des Populismus: Solariumgebräunte Vertretertypen mit strahlendem Lächeln und flotten Frisuren, die ihrer verunsicherten Kundschaft den Notausgang aus der Gegenwart versprechen. Es ist kein Zufall, dass der mächtigste politische Slogan heute „Es war einmal ...“ lautet, wie es der US-amerikanische Essayist Mark Lilla unlängst formulierte. Früher wollte niemand aus der Zeit gefallen sein, heute sehnen sich immer mehr Menschen danach.
Diejenigen, die nicht an die Märchen von der guten alten Zeit glauben, benötigen Strategien des Umgangs mit innerer und äußerer Unruhe. Das Problem lässt sich nicht einfach so an der Wurzel packen, sondern ähnelt vielmehr einem lästigen Juckreiz auf der Hirnrinde – an
einer Stelle also, die sich nicht kratzen lässt, weil man dazu die Schädeldecke abheben müsste. Und genau das führt uns zurück zu der eingangs erwähnten Gelassenheit. Denn lässt sich die Ursache des Juckens nicht unmittelbar beheben, muss man lernen, mit dem Reiz umzugehen.
Es gibt mindestens drei Lebensbereiche, in denen Gelassenheit heutzutage notwendiger denn je ist: im Umgang mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und zu guter Letzt mit den sozioökonomischen Rahmenbedingungen – also dem Chaos da draußen.
Stoisch bleiben Fangen wir nun mit der Vogelperspektive an und zoomen uns schrittweise in das Thema hinein. Wer angesichts der turbulenten und – seien wir ehrlich – oftmals furchteinflößenden Nachrichtenlage nicht zwischen Aufgeregtheit und Apathie pendeln will, sollte sich schleunigst mit einer antiken philosophischen Denkschule vertraut machen, nämlich mit der Stoa, bei der es darum geht, möglichst gelassen nach der Weisheit zu streben und ein ausgeglichenes Leben zu führen. Einer der bekanntesten Stoiker war ein ehemaliger römischer Sklave und späterer Lehrer namens Epiktet, der zur Einsicht gelangte, dass man zwischen Dingen unterscheiden müsse, auf die man als Einzelner Einfluss hat, und Zuständen, die sich außerhalb der eigenen Wirkungsmacht befinden, sofern man nicht permanent am Weltgeschehen verzweifeln möchte.

Diese alte Erkenntnis ist heute relevanter denn je, denn durch die – auch digital bedingte – Allgegenwärtigkeit aller Krisen dieser Welt besteht die Gefahr, dass einem das Gespür für die real existierenden Herausforderungen des Alltags abhandenkommt. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Es macht relativ wenig Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie man ‚die Flüchtlingskrise‘ lösen könne, weil derartige Überlegungen meist zu gut gemeinten Allgemeinplätzen führen, die mit „Man müsste doch ...“ oder „Würde man bloß ...“ beginnen. In diesem Zusammenhang ist es viel nützlicher (und auch befriedigender), konkret darüber nachzudenken, ob beziehungsweise wie man selbst in der Lage wäre, auf die Situation einzuwirken – beispielsweise, indem man Menschen, die bereits hier sind, als Mentor, Sprachcoach oder Spender unterstützt. Es gibt übrigens zahlreiche aktuelle Indizien dafür, dass die antiken Stoiker recht hatten und es tatsächlich oft besser ist, nichts zu tun und den Dingen ihren Lauf zu lassen, als sich in kontraproduktivem Aktionismus zu erschöpfen. Ein Beispiel aus der Finanzbranche: Anleger, die ihre Aktiendepots nicht ständig umschichten, fahren langfristig besser als hyperaktive Investoren, die auf jede Schlagzeile reagieren und nicht aufhören können, nach Schnäppchen Ausschau zu halten.
Mit ein Grund für diese Diskrepanz ist die allgegenwärtige Gefahr der Selbstüberschätzung – womit wir bei der zweiten Vergrößerungsstufe angelangt wären: den lieben Mitmenschen. Dass viele Diskussionen heutzutage verkrampft verlaufen und mehr an einen Zusammenstoß der gekränkten Eitelkeiten erinnern als an einen anregenden Austausch von Meinungen, hängt zu einem beträchtlichen Teil mit blinden Flecken und mentalen Trugschlüssen zusammen, an denen wir alle laborieren.
Die wichtigste Zutat zu einem entspannten Leben ist naturgemäß die eigene Einstellung.
Eine besonders tückische kognitive Verzerrung ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, der von den Psychologen David Dunning und Justin Kruger entdeckt und im Jahr 1999 erstmals beschrieben wurde. Vereinfacht ausgedrückt wirkt er sich folgendermaßen aus: Je inkompetenter eine Person, desto eher tendiert sie dazu, ihr Wissen zu überschätzen und die Expertise ihres Gesprächspartners zu ignorieren. Angesichts der Tatsache, dass Internet und soziale Netzwerke immer mehr dazu verleiten, zu allem jederzeit eine Meinung abzusondern, lässt sich dieser Effekt immer öfter beobachten.
Doch auch der entspannte Umgang mit den Schattenseiten der zwischenmenschlichen Kommunikation im Zeitalter von Facebook, Twitter und Co lässt sich erlernen. Ein wichtiger Tipp stammt aus der Feder von Asfa-Wossen Asserate, dem Großneffen des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie, der nach dem Sturz des Kaiserhauses in den 1970er-Jahren in Deutschland gestrandet war. Er lautet folgendermaßen: Es muss nicht alles ausdiskutiert werden oder, um es vornehmer auszudrücken: „Das Dozieren ist von alters her in der Konversation streng verboten.“ Wer aufhört, jedes Gespräch als Teil des Kreuzzugs für die einzige Wahrheit zu betrachten, hat es heutzutage leichter. Auch Dale Carnegie, der 1955 verstorbene Altmeister der Lebensberatung, bietet sachdienliche Hinweise, sofern man bereit ist, über die altmodisch-melodramatische Tonlage seiner Werke hinwegzusehen. Ein zentraler Ratschlag Carnegies wurde mittlerweile von der modernen Psychologie bestätigt: Eine emotional aufgeladene Debatte lässt sich nicht rein rational führen. Wer seinen Gesprächspartner von etwas überzeugen will, muss dafür sorgen, dass dieser in seiner persönlichen und sozialen Identität bestärkt wird. Positiver Nebeneffekt dieses Ansatzes: Auch die Gesprächsatmosphäre entspannt sich.
Apropos Identität: Die wichtigste Zutat zu einem entspannten Leben ist naturgemäß die eigene Einstellung – womit wir bei der dritten und letzten Vergrößerungsstufe angelangt wären. Die wichtigste Erkenntnis in dem Zusammenhang ist, dass nicht nur andere Menschen an kognitiven Verzerrungen leiden, sondern auch wir. Weder bleiben wir vom Dunning-Kruger-Effekt verschont, noch sind wir immun gegen die Verlockung des Dozierens. Und selbstverständlich wollen auch wir ernst genommen werden und uns wichtig fühlen. Je mehr wir diesen Impulsen nachgeben, desto weiter entfernen wir uns vom Zustand der Gelassenheit.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 104: „Wie Gelassenheit geht"
Als der französische Philosoph Voltaire seinen tragikomischen Romanhelden Candide auf einen Horrortrip rund um den Globus schickte, wollte er sich über den nai ven Optimismus der Aufklärung lustig machen. Doch am Ende seiner haarsträubenden Odyssee durch Krieg, Inquisition, Elend und Sklaverei gelangte der leidgeprüfte Candide zum selben Schluss wie Epiktet knapp zwei Jahrtausende zuvor. „Il faut cultiver son jardin.“ Man muss den eigenen Garten pflegen. Dieses Motto ist in unruhigen Zeiten wichtiger denn je – im wortwörtlichen wie auch im übertragenen Sinn.