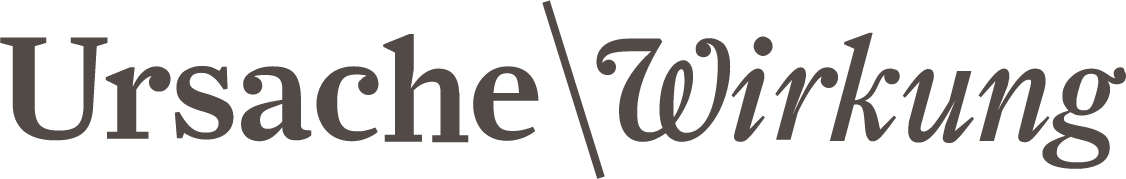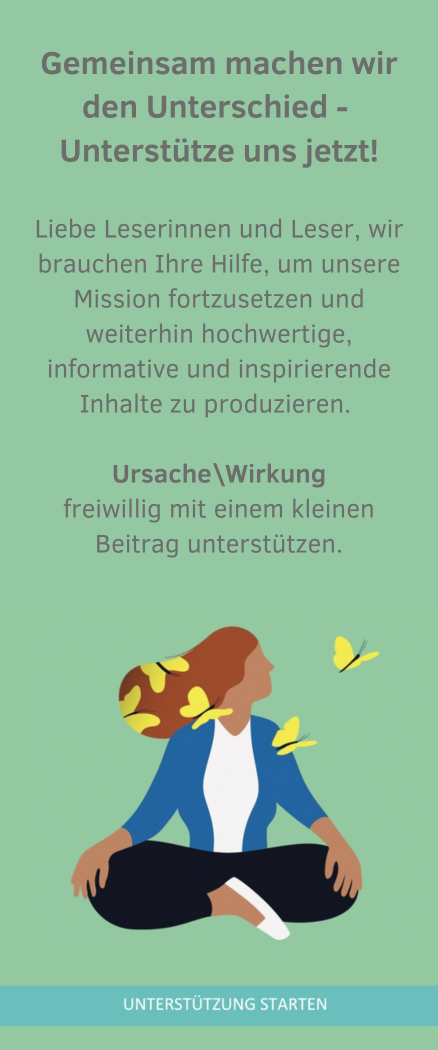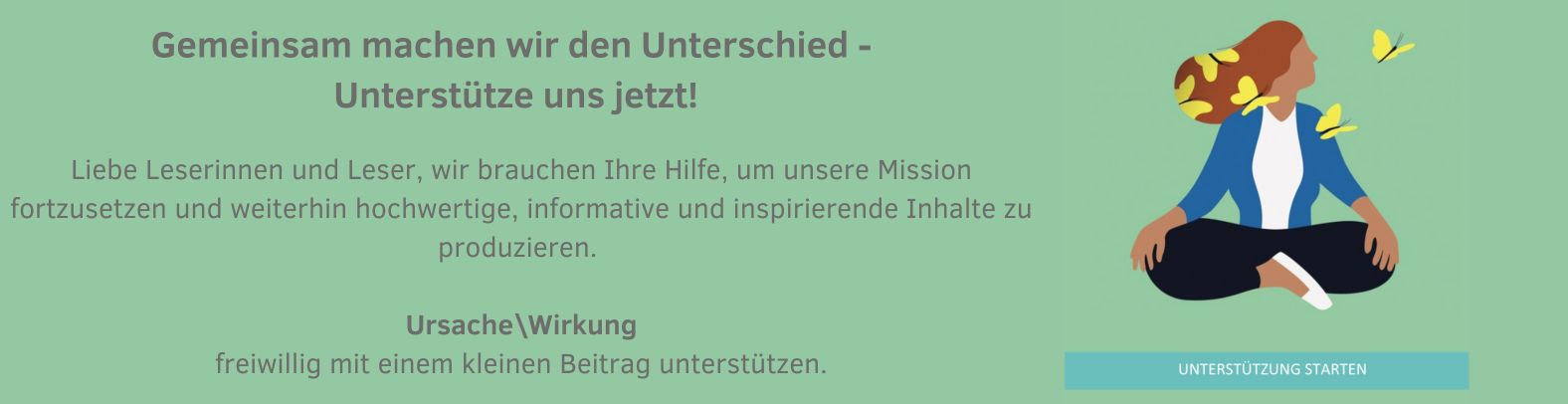Der deutsche Neuropsychologe Martin Grunwald erforscht den Tastsinn des Menschen. Über ihn erschließt sich die Welt, sagt er, doch die wenigsten sind sich dessen bewusst.
Der Mensch ist die Summe der Sinneseindrücke, die auf ihn einwirken. Sie sind einer der wenigen Wissenschaftler, die sich mit dem Tastsinn beschäftigen. Wie kam es dazu?
Eher zufällig, wie so vieles im Leben. Ich interessierte mich schon immer für das menschliche Gehirn. Nach meinem Studium an der Universität Jena hatte ich die Möglichkeit, in einem EEG-Labor mitzuarbeiten. Dort wurden die Gehirnströme gemessen und analysiert. Was macht das Gehirn, wenn wir uns Bewegungen vorstellen? So lautete die Fragestellung dieses ersten Projektes. Dabei galt es zu klären, wie stark sich die bildliche Vorstellungskraft in der Gehirnaktivität widerspiegelt. Wir haben schnell beobachtet, dass die Vorstellungskraft bei Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Beim einen ist sie besser, beim anderen schlechter.
Das erklärt noch nicht Ihre Hinwendung zum Tastsinn.
Stimmt, die Vorstellungskraft war nur der Anfang, denn an und für sich hatte ich mit dem Tastsinn eigentlich gar nichts am Hut. Das kam erst in einem Folgeprojekt, das aber auch mit der Vorstellungskraft zu tun hatte. Wir verbanden Probanden die Augen und baten sie, ein Relief abzutasten und im Anschluss dann aufzuzeichnen, was sie glaubten, ertastet zu haben. Das gelang den meisten sehr gut. Nur eine einzige Person konnte das überhaupt nicht. Es war eine sehr intelligente, junge Frau, die aber anscheinend keinen Konnex zwischen den ertasteten Reliefelementen herstellen konnte.
Und deshalb blieben Sie dran?
Genau, ich blieb am Tastsinn hängen. Wir konnten viel später herausfinden, dass diese Frau an Magersucht leidet und Magersucht offensichtlich sehr stark mit gestörten neuronalen Prozessen der Körperwahrnehmung und einem gestörten Tastsinnessystem zusammenhängt. Daraus haben wir dann die neurobiologische Sicht auf die Anorexie und insbesondere auf das gestörte Körperschema entwickelt.

Warum beschäftigen sich so wenige Forscher mit dem Tastsinn?
Von Plato bis Descartes wurde die Auffassung vertreten, dass der Tastsinn eher ein tierischer und daher ein unwichtiger, niederer Sinn sei. Diese Auffassung hatte Folgen bis in die Neuzeit der modernen Wissenschaft. Auch heute denken noch viele Forscher, dass der Tastsinn ein untergeordnetes Sinnessystem sei und der visuelle Sinn in der Hierarchie ganz oben stehe.
Das allein ist der Grund?
Nein, neben den strukturellen Problemen ist es natürlich so, dass es sich beim Tastsinn um ein komplexes System handelt. Im Vergleich zu allen anderen Sinnen kann der Tastsinn nicht wie etwa das Auge, das Ohr, die Zunge oder die Nase im Körper lokalisiert werden. Er befindet sich im ganzen Körper. Quasi überall. Wir schätzen, dass ein Mensch zwischen 700 und 900 Millionen Rezeptoren am Körper verteilt hat. Der Tastsinn ist also auch quantitativ das größte Sinnesorgan. Es wissenschaftlich zu analysieren und zu verstehen ist eine extreme Herausforderung.
Können Sie das näher ausführen?
Während das Auge, die Nase, die Ohren und die Zunge Sinneseindrücke vornehmlich von außen registrieren, verarbeitet der Tastsinn Eindrücke von außen und innen. Wir erkennen das Gewicht und die Wärme eines Objekts außerhalb, gleichzeitig haben wir auch ein inneres Gefühl für die eigene Körperwärme und das Körpergewicht. Die nach innen gerichtete Signalauswertung informiert aber auch ständig darüber, wie unsere Gliedmaßen beschaffen sind, wo sie sich im Raum befinden. Dafür sind keine visuellen Eindrücke nötig. Alles passiert automatisch, entzieht sich der Selbstbeobachtung.
Der Mensch ist sich dessen nicht bewusst?
Der Tastsinn verortet den Körper in der Welt. Wir Menschen wissen zu jedem Zeitpunkt, wo unser Kopf, unsere Beine und Arme sind. Jeder Mensch, auch der, der blind oder taub geboren ist, hat eine genaue innere Vorstellung von der räumlichen Struktur des eigenen Körpers. Wir nennen es Interozeption und Propriozeption.
Also die Selbstwahrnehmung. Ist der Tastsinn damit Grundvoraussetzung für unser Bewusstsein über die eigene Existenz?
Genau, der Tastsinn liefert den inneren dreidimensionalen Bauplan unseres Körpers. Deshalb ist er unverzichtbar. Ohne ihn würden wir nicht sicher wissen können, dass wir auf der Welt sind. Deshalb ist der Tastsinn auch bewusstseinsbildend. Er hilft zu erkennen, dass es etwas physisch Reales außerhalb unseres Körpers gibt und dass unser Körper selbst eine physische Einheit darstellt.
Ich fühle, also bin ich, könnte man sagen?
Ja, das ist die bewusstseinsphilosophische Dimension des Tastsinns. In der ursprünglichen Formulierung von Descartes (Anmerkung: „Ich denke, also bin ich.“) fehlt die körperliche Dimension des Menschseins völlig. Dabei nehmen wir unsere eigene Existenz nicht als abstrakten Gedanken wahr, sondern als sinnliches Ereignis, das sich aus den Informationen des Tastsinns speist. Deshalb gibt es in der Natur den Totalausfall des Tastsinns auch nicht. Kein Organismus lebt ohne diesen Sinn. Der Tastsinn schläft auch praktisch nie.
Wie meinen Sie das?
Wenn man die Augen zumacht, muss das Gehirn keine neuen Eindrücke verarbeiten. Beim Tastsinn ist es anders, weil er ja auch eine Warnfunktion hat. Die Menschen registrieren auch im Schlaf ein Erdbeben. Man wacht auf, wenn man im Schlaf berührt wird. Man spürt, wenn einem zu heiß ist oder man zu nahe an der Bettkante liegt. Wie die 100 Milliarden Neuronen im Gehirn diese Prozesse genau regulieren, wissen wir auch nach 150 Jahren intensiver Forschung noch nicht.
Frustrierend?
150 Jahre ist im Vergleich zur Menschheitsgeschichte eine sehr kurze Zeit. Wir wissen einiges, sind aber, was den Tastsinn betrifft, bei 95 Prozent noch ziemlich ahnungslos.
Welche Rolle spielt das Gehirn?
Die Neuronen des Gehirns und des Rückenmarks gelten als die Verarbeitungsinstanz aller sensorischen Ereignisse. Wie das Gehirn diese Milliarden an Signalen pro Millisekunde ordnet, verwaltet und verarbeitet, wissen wir eben nicht. Selbst die Beschreibung der einzelnen Prozesse, die in und an einer einzelnen Nervenzelle stattfinden, weist noch Lücken auf. Insofern sind wir weit davon entfernt, so komplexe Prozesse wie die Bewusstseinsbildung durch neuronale Aktivität zu begreifen. Aktuell nimmt man an, dass die rechte Hirnhemisphäre einen wesentlichen Beitrag leistet.
Ist das Gehirn bei allen Menschen gleich aufgebaut?
In groben Zügen schon. Es funktioniert nach vergleichbaren biologischen Prinzipien, denn sonst könnten sich die Menschen untereinander ja kaum verstehen. Der Tastsinn ist auch bei allen Menschen ähnlich sensibel. Er lässt sich trainieren. Manuelle Tätigkeiten führen dazu, dass sich die Neuronengebiete, die dafür verantwortlich sind, vergrößern. Wer trainiert, wird also auch seine Empfindlichkeit steigern können.
Es hängt also doch auch von vielen äußeren Faktoren ab?
Absolut. Der Tastsinn entwickelt sich bereits im Mutterleib, dann in der Kindheit und prägt uns damit für das ganze Leben. So wie alle anderen Sinnesorgane auch lässt der Tastsinn mit dem Alter nach. Die gute Nachricht: Er lässt sich aber trainieren. Es gibt eine Studie unter Physiotherapeuten, also Menschen, die sehr körperlich arbeiten. Sie zeigt, dass die Sensitivität sehr stark davon abhängt, wie sehr sie gebraucht wird. Die Tastsensibilität eines 60-jährigen Physiotherapeuten ist der eines 20-jährigen durchaus vergleichbar.
Denken Sie, der Tastsinn ist in der modernen Welt vernachlässigt?
In der industrialisierten Welt nehmen wir ihn kaum mehr als überlebenswichtig wahr. Er wird auch wenig stimuliert. Meistens berühren wir nur Oberflächen aus Kunststoffen, Glas oder Metall. Die mehrdimensionale haptische Erfahrung im Umgang mit Materialien ist den Menschen zumeist abhandengekommen. Alles Körperliche wird sehr schnell ins Reich der Ideologie verbannt.
Was meinen Sie mit Ideologie?
Zum Beispiel die Tatsache, dass jede Alltagsberührung sehr schnell als sexueller Übergriff bewertet und stigmatisiert wird. Dass es aber ein völlig von Sexualität losgelöstes Berührungsbedürfnis zwischen Menschen gibt, wird oft ausgeblendet. Dabei drücken sich doch Gefühle wie Freude, Mitgefühl, Sympathie und Sorge immer auch körperlich aus. Dadurch erklärt sich auch der Wunsch der Menschen, wieder zu sich zu kommen.
Meditation ist für viele ein Weg?
Das ist eine sehr kognitive Sache. Es gibt sicherlich Menschen, die auf diesem Weg eine Einheit zwischen sich und der Umwelt herstellen können. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Meditation die Hirnaktivität verändert. Es ist ein ähnlicher Zustand wie unter Narkose. Körperlich, im Sinne der haptischen Erfahrung, ist Meditation allerdings nicht.
Körperlichkeit ist aber wichtig, behaupten Sie?
Es ist ein Grundbedürfnis, meine ich. Hier in Leipzig sind derzeit sogenannte Kuschelkurse extrem erfolgreich. Menschen zahlen 60 Euro und bekommen dafür 45 Minuten Umarmungen. Das hat nichts mit Sex zu tun. In unserer Kultur ist in dieser Hinsicht anscheinend ein Bedürfnis nach Berührung entstanden, zumindest beobachte ich das.
Was leiten Sie daraus ab?
Ich bin überzeugt, dass wir uns am intensivsten spüren, wenn wir im direkten Kontakt mit einem anderen Lebewesen sind. Da spüren wir, dass wir nicht alleine sind. Körperberührungen lösen auch ein biochemisches Konzert im Körper aus. Sie gehören zu einem glücklichen, gesunden Leben.