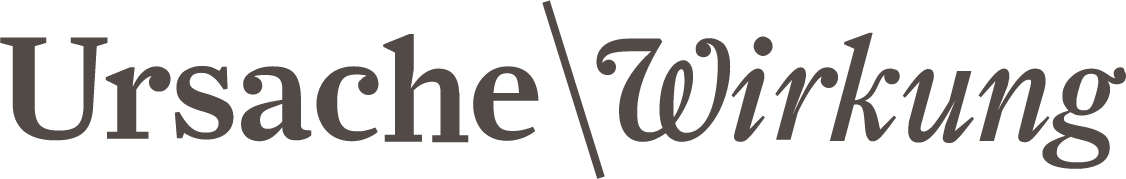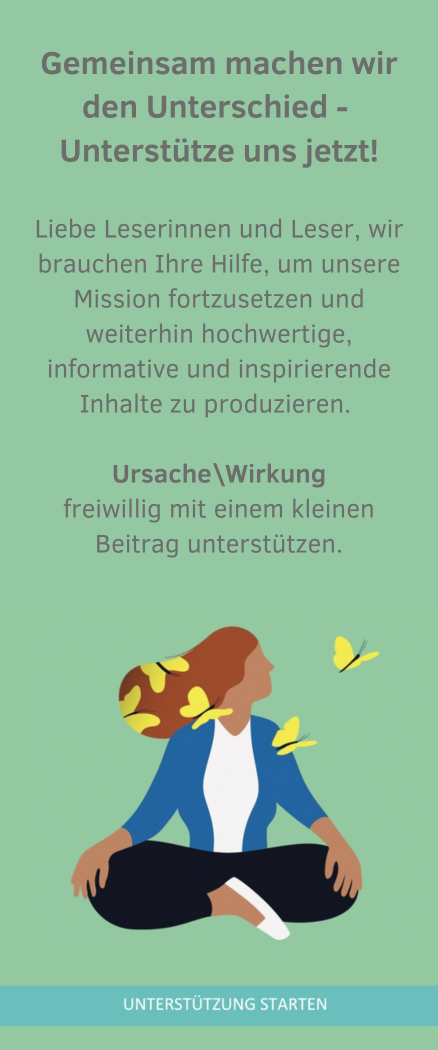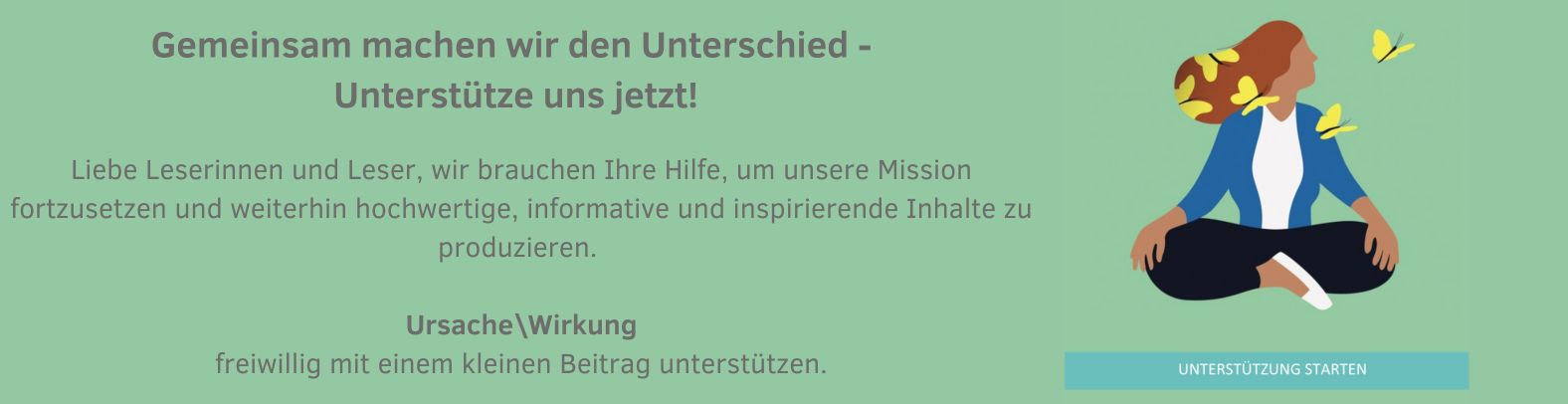Wer mutig lebt, verlässt die Komfortzone. Nur so kann man Lebensfreude finden. Was macht man mit einem Gefühl, das man nicht haben will? Manchmal hilft ignorieren, dann ist es weg. Aber es hilft nicht immer.
Was, wenn es sich nicht einfach wegignorieren lässt? Zum Beispiel Angst. Dann hilft: Hinschauen! Wovor genau habe ich Angst? Und was könnte schlimmstenfalls passieren? Dabei nicht den Atem anhalten, sondern weiteratmen. Das Gefühl körperlich annehmen, es da sein lassen. Es mir aneignen, mich vielleicht sogar damit befreunden. Immerhin ist es ja da, es bewegt mich, es motiviert mich, und wenn ich es ablehne, dann lehne ich einen Teil von mir selbst ab.
Der von dem buddhistischen Psychotherapeuten John Welwood geprägte Begriff des ‚Spiritual Bypassing‘ beschreibt das in Kreisen von Meditierenden allzu oft praktizierte Überspringen von ungeliebten Gefühlen, um schnellstmöglich in den favorisierten Zustand der Gelassenheit einzutreten. So sehr wir die Gelassenheit auch schätzen: Wenn wir auf dem Weg dorthin unsere Gefühle unterdrücken, werden sie uns krank machen oder uns aus dem Dunkel der Verdrängung irgendwann hinterrücks überfallen.
Wenn wir hingegen ihr Dasein respektvoll wahrnehmen – ihren Handlungsimpulsen brauchen wir dabei nicht zu folgen –, stehen sie uns als Energieressource zur Verfügung. Das gilt auch für die Angst. Weglaufen kann unseren Körper retten. Weglaufen vor einer Herausforderung jedoch vergrößert die Angst nur noch. Da ist es besser, hinzuschauen. Der direkte Blick ins Auge der Angst verwandelt sie in eine konkrete Furcht vor etwas: „Aha, davor fürchte ich mich also!“ Meist folgt dann ein Gefühl von „Ist doch halb so schlimm“ oder die Angst verschwindet sogar völlig, sie hatte sich nur hinter unserem Rücken so groß aufplustern können.
Manchmal hilft ein Vergleich mit einem Menschen, der wirklich Grund hatte, sich zu fürchten. Dieser Tage las ich von Rachel Hanan, die jetzt 90 Jahre alt ist und in Haifa, Israel, lebt. Sie hatte zusammen mit ihrer Schwester in Auschwitz unter dem KZ-Arzt Mengele ein Jahr lang – von Mai 1944 bis Mai 1945 – dessen grausame Experimente überlebt. Wie hatte sie das geschafft? „Wir fühlten nichts“, sagt sie heute dazu. „Mein Überlebensmechanismus hat alle Emotionen unterdrückt und gekappt, sonst hätten sie mich von innen getötet. Ich war ein Jahr lang nicht am Leben.“ Bis zum Alter von 50 Jahren hatte Rachel über diese Erlebnisse nicht sprechen können, sie hätte es seelisch nicht verkraftet.
 Was Emodiversity ist
Was Emodiversity ist
Unsere Schrecken und Ängste sind im Vergleich dazu lächerlich klein, auch wenn sie uns groß erscheinen. Aber das Prinzip ist dasselbe: Etwas nicht zu fühlen, weil wir glauben, das Gefühl nicht ertragen zu können, macht uns zu emotionalen Zombies. Rachel hat es geholfen, zu überleben. Die meisten Situationen erlauben uns heutigen Erwachsenen jedoch ein gewisses Maß an Gefühlsausdruck, zumindest ein inneres Registrieren von „Ja, ich habe Angst“ oder „Ja, ich bin wütend“.
Das beugt nicht nur Verdrängung, Affekthandlungen und psychosomatischen Krankheiten vor. Der Ausdruck von Gefühlen – auch der negativen – macht uns ganz allgemein gesünder, haben neuere Forschungen zur Emodiversity festgestellt. Diversity, zu Deutsch Vielfalt, ist nicht nur in der Natur und Kultur, insbesondere auch in der Landwirtschaft Thema, sondern offenbar auch im Gefühlsleben, besagen diese Studien. Menschen, die viele unterschiedliche Gefühle erleben, sind im Durchschnitt gesünder. Bei allem Respekt für die von Buddha empfohlenen Tugenden der Paramitas ist ein Rund-um-die-Uhr-Verweilen in mitfühlender Güte und Gelassenheit nicht das, was unser Hausarzt empfehlen würde. Zudem verbieten die Paramitas ja nicht das Fühlen von Gefühlen, sie sind eher Handlungsanweisungen: „Laufe nicht gleich davon, wenn du Angst hast! Greife nicht gleich an, wenn du wütend bist!“
Viele unserer Ängste sind unkonkret. Dazu gehören auch die diffuse, unspezifische Existenzangst und die Angst vor der Leere, dem Nichts, dem Niemandsein. Warum gibt es mich überhaupt? Sollte, darf es mich geben? Hat mein Leben Sinn? Bin ich jemand? Ist das Leben, das sich von Moment zu Moment in immer neuer Weise zeigt, voller Überraschungen und nie ganz vorhersehbar, ist es nicht eine ständige Bedrohung? Meditation ist ein Einsinken in das, was ist. Angst kann das behindern, denn Meditation, die mehr ist als nur autogenes Training oder Reprogrammierung mit Affirmationen oder Mantras, konfrontiert immer mit dem Nichts, der Leere, der Grenzenlosigkeit und Haltlosigkeit, dem nicht Versicherbaren. Sich dort hineinfallen lassen zu können braucht ein gewisses Maß an Angstfreiheit vor der Ich-Auflösung. Es braucht Hingabe. Liebe und Meditation ähneln sich in der Hinsicht, dass beide Hingabe verlangen und ihr Kontrahent die Angst ist.
Angst als Ressource
Angst hindert uns daran, eine Situation, so wie sie ist, erst einmal als solche anzunehmen. Das Hinnehmen beziehungsweise Annehmen, wie es ist, ja sogar Frieden schließen mit dem Status quo, so wie wir es in der Liebe und in der Meditation erleben, heißt jedoch nicht, dass wir eine vorhandene Situation nicht ändern dürften. Es heißt nur, dass wir vor der Aktion der Änderung zunächst den Status quo als solchen hinnehmen müssen, sonst ist unsere Aktion, wie gut gemeint sie auch immer sein mag, irreal, weil sie von etwas ausgeht, das nicht der Fall ist.
Angst ist das Etikett auf einer Gefühlsressource, die wir in ihrer freien Verfügbarkeit noch nicht erkannt haben. Wut, Liebe, Lust, Gier, Ekel, Trauer sind weitere solche Etiketten, die wir auf Affekte kleben, die ‚uns ergreifen‘, als seien wir ihr Opfer und könnten nichts dagegen tun. Wenn wir sie jedoch als Ressource erkennen, die wir mit dem jeweiligen Etikett nur uns einschränkend geframt haben, dann sind wir nicht mehr ergriffen, sondern können ergreifen. Oder sind dazwischen, in der Schwebe zwischen Täter- und Opfersein, ergriffen und ergreifend, hingegeben und bewusst tätig.
Mutig zu leben heißt, sich aus der Komfortzone herauszuwagen, in der wir uns durch eine Vielfalt von Lebenslügen vor einer als Bedrohung empfundenen Realität abgeschottet haben. Und das nicht nur einmal, sondern als tägliche Praxis. Lebensgenuss und Lebensfreude, das Abenteuer des realen Lebens, gibt es nur außerhalb des Schneckenhauses. Denn es ist Lebensangst, wenn wir uns unter dem Vorwand des Schutzes verkriechen.
Ein täglicher Reality-Check („Wovor habe ich denn heute Angst?“) kann helfen, die Tür nach draußen wieder zu öffnen. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Bereitschaft, ihr ins Auge zu sehen und nicht wegzulaufen. Zivilcourage ist der Mut, der Angst vor sozialer Verurteilung ins Auge zu sehen und trotz dieser Angst das zu tun, was das Gewissen für richtig hält. Wenn wir bei unserem täglichen Reality-Check eine Angst entdeckt haben, sollten wir sie freundlich begrüßen und ihr sagen: „Aha, da bist du, willkommen in meinem Leben, du gehörst mit dazu!“ Und dann sollten wir das tun, was nötig ist, was Frieden schafft, die Liebe fördert und das Gewissen für richtig hält.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.
Bilder © Pixabay