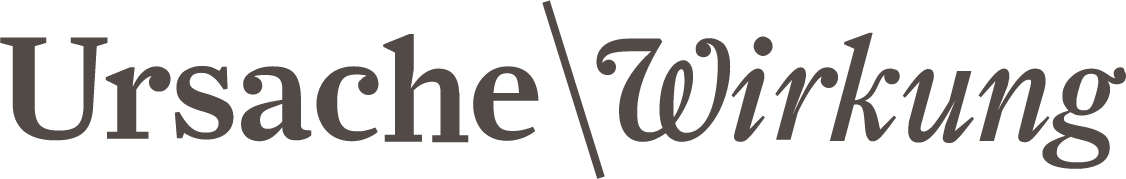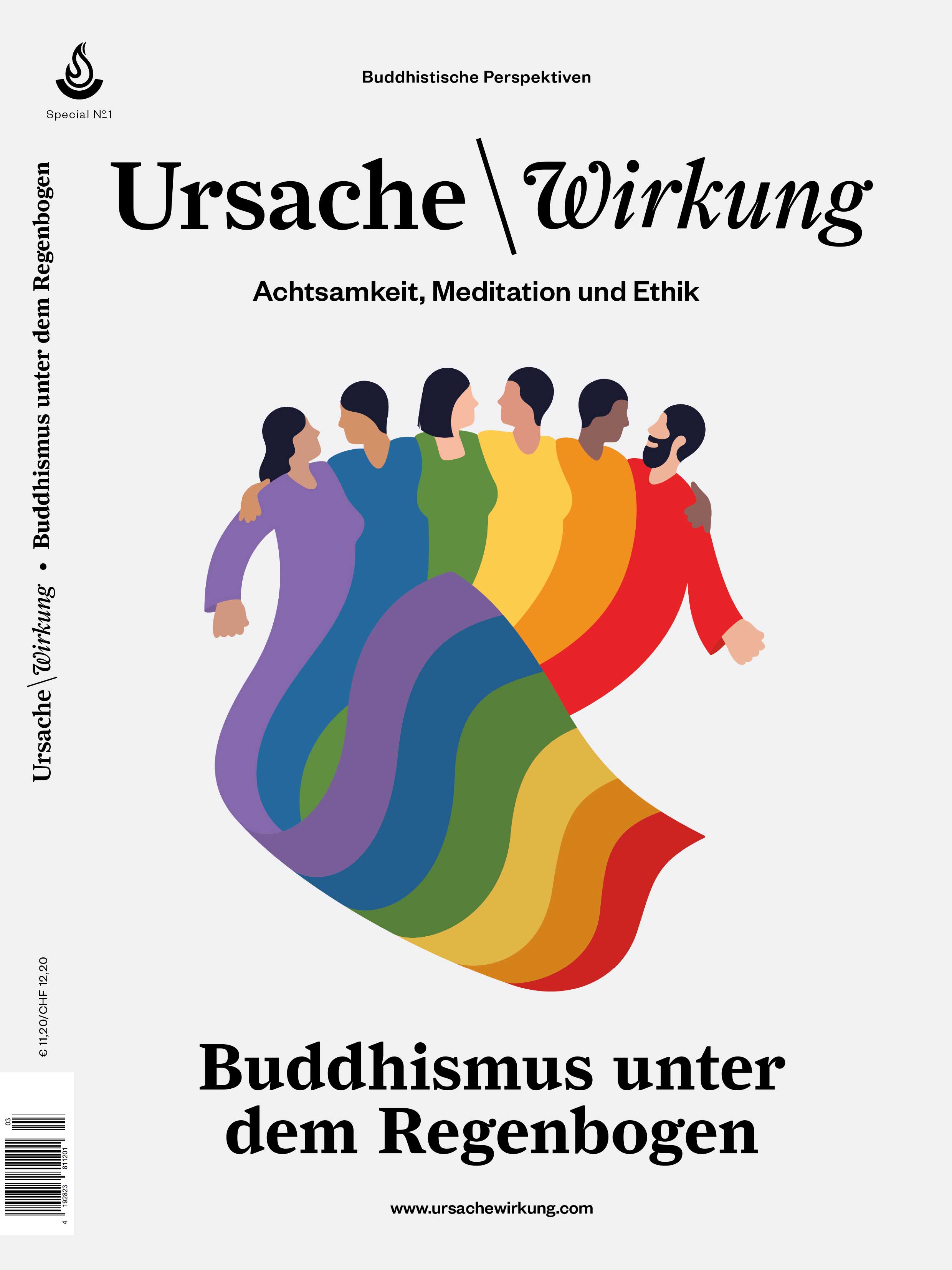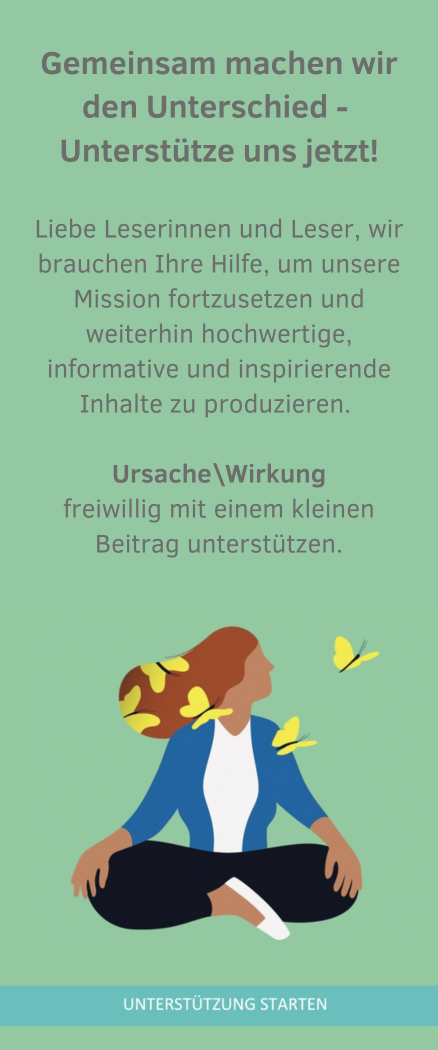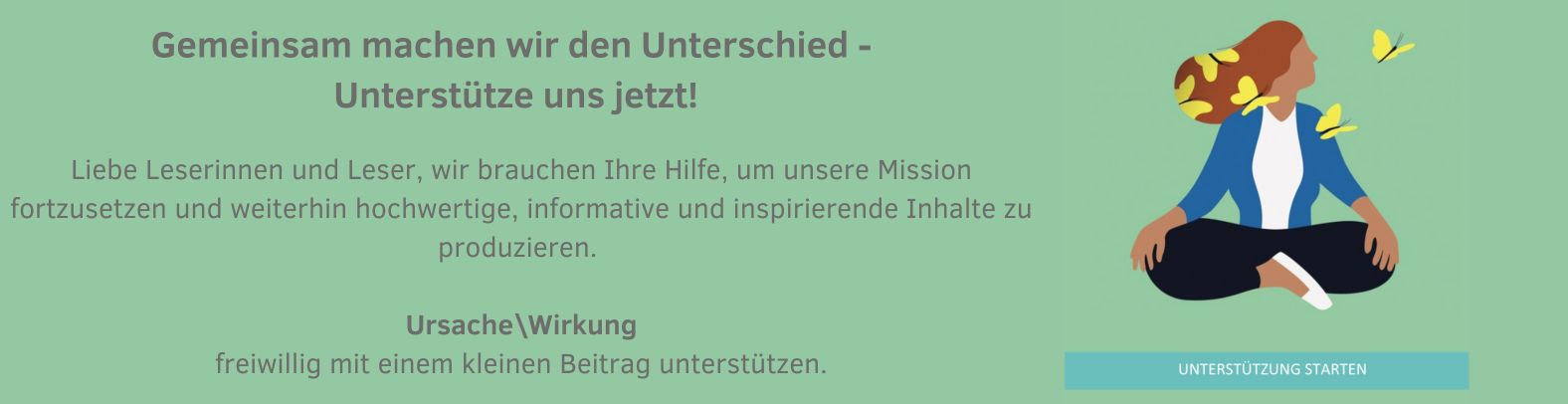Buddhistische Lehren können für die Selbsterkenntnis und die Selbstgestaltung hilfreich sein – aber auch für gezielte Ausgrenzung missbraucht werden.
Psycholog*innen gehen ebenso wie Buddhist*innen davon aus, dass Identitäten keine unveränderlichen Wesensbestandteile sind. Identität bildet sich, wenn Menschen sich mit Merkmalen einer Gruppe identifizieren. Identität ist somit eine Möglichkeit der Selbstgestaltung. Dass sie nicht fest und unveränderlich ist, zeigt sich schon am ständigen Wandel von Normen in unserer Gesellschaft und dem sich ändernden Selbstverständnis der Akteur*innen.
Identität zwischen Tradition und Aufbruch
Fragen gesellschaftlicher Emanzipation sind immer auch Identitätsfragen. Die Frauenemanzipation war Ausdruck eines geänderten Selbstbewusstseins und eines daraus resultierenden Anspruchs auf Rechte und gesellschaftliche Partizipation. Das Selbst- und Fremdbild von Frauen änderte sich so ebenfalls. Ein weiteres, ein buddhistisches Beispiel findet man in Indien. Dr. Ambedkar war ein Mitglied der Kaste der sogenannten Unberührbaren. Er schrieb die indische Verfassung mit und kämpfte für soziale Reformen. Ambedkar erkannte, dass Befreiung eine kulturelle und auch spirituelle Frage ist. Die hinduistische Bezeichnung „Unberührbar“, die zwischen rituell „reinen“ und „unreinen“ Gesellschaftsgruppen innerhalb des indischen Kastensystems trennt, lehnte er ab und wählte die Selbstbezeichnung „Dalit“. 1956 trat er mit mehr als 300.000 anderen Dalits geschlossen zum Buddhismus über. Die Bilder der Zeremonien von Menschenmassen in weißer Kleidung hatte eine immense Wirkung in einer Gesellschaft, die bis dahin Dalits aus dem öffentlichen Leben ausschloss und in eigene Siedlungen verbannte. Der indische Sozialreformer Ambedkar gab damit vielen Dalits eine neue Identität als spirituell Praktizierende auf einem gemeinsamen Pfad.
Die queere Emanzipation im Westen begann auch mit einer Identitätsfrage. Die fremdbestimmten Identitätskonstrukte als „psychologisch krank“, „unnatürlich“ und defizitär wurden abgelegt. Stattdessen wurden negative Worte wie „schwul“ als kämpferisch positiv umgedeutet. Die ehemals „Kranken“ und „Perversen“ wollten liebevolle und sorgende Beziehungen eingehen und auch als vollwertig anerkannte Familien Kinder großziehen. Diese Emanzipationsbewegung änderte Selbst- und Fremdbild von queeren Menschen.
Menschen und ganze Gesellschaften schaffen Identitätskonstrukte, die sie für sich und andere geltend machen. Zu glauben, solche Identitätskonstrukte sind für die buddhistische Praxis nicht relevant oder gar schädlich, ist höchst problematisch. Es besteht die Gefahr, dass diskriminierende Identitätskonstrukte konserviert werden. So finden wir im Buddhismus die Vorstellung einer angeblichen spirituellen Minderwertigkeit von Frauen sowie den Ausschluss von sexuellen und geschlechtlichen Minoritäten.
Anatta und Identität
Es spricht einiges dafür, dass Buddha die Lehre von Anatta als schwierig ansah. Anatta, zu Deutsch „Nicht-Selbst“ oder „Nicht-Ich“, bedeutet, dass Menschen kein festes, unveränderliches oder unabhängiges Selbst besitzen. Das, was als „Ich“ wahrgenommen wird, ist vielmehr konstruiert.
An einer Stelle verneint der Buddha beide Positionen: Existenz und Nichtexistenz des Selbst. Und als der Wandermönch Vacchagotta, der Buddha mehrmals mit schwierigen oder gar unlösbaren Fragen konfrontierte, ihn fragte, ob das Selbst existiere, schwieg dieser. Einige Gelehrte interpretieren dieses Schweigen so, dass diese Fragen Missverständnisse mit sich bringen, weshalb sich Buddha in der Erörterung des Themas zurückgehalten haben soll. Es drohen aber nicht nur Missverständnisse, sondern auch konkrete Gefahren, wenn die Idee vom Nicht-Selbst in unlauterer Weise gebraucht wird.
Manche Budhist*innen missbrauchen die Lehre von Anatta als Waffe, meint etwa Akāliko Bhikkhu. Die Erfahrungen über Identität seien nicht echt, oder es komme darauf nicht an. Akāliko Bhikkhu ist Gründer der australischen queeren buddhistischen Gruppe „Rainbodhi“ und führt aus: „Oft werden queere Menschen beschuldigt, von ihrer Identität besessen zu sein und sich an einen Aspekt des Selbst zu klammern, weil wir über unsere Erfahrungen als queer, trans und intersexuelle Buddhisten reden in einer Art, die sich auf unsere Identität bezieht. Manche verweisen dann auf die Doktrin von Anatta und meinen, dass diese Identitäten nicht existieren, reine Illusion seien oder es darauf nicht ankomme. Manche sagen auch, dass die Fokussierung auf eine Identität konträr sei zu buddhistischen Lehren.“
Das Problem sei, so Akāliko Bhikkhu weiter, dass die Diskriminierung, die Vorurteile und die Gewalt, die queere Menschen erfahren, real seien. So gebe es deshalb etwa eine höhere Selbstmordrate unter Transmenschen, aber auch unter queeren Jugendlichen. Psychische Probleme und Drogenmissbrauch kommen häufiger vor. Wenn die belastenden Verhältnisse ausblendet werden, trivialisiert man nicht nur diese Erfahrungen, sondern man blendet auch die positiven Dinge aus. Queere Buddhist*innen leiden darunter, wenn ihre Lebensweise im Gegensatz zu der der anderen Sangha-Mitglieder unsichtbar ist.
Es heißt, queere Menschen würden leiden, weil sie an ihrer Identität hängen und nicht aufgrund der Verhältnisse. Akāliko Bhikkhu entgegnet dieser Vorstellung, dass eine queere Identität nicht automatisch leidvoll sei und auch keine Ursache des Leidens sei – jedenfalls nicht mehr oder weniger als jede andere Identität. Dies sei ein wichtiger Gedanke, und man solle genauer hinsehen: Die Bildung einer „queeren Identität“ beginne meist mit dem „Coming-out“. Ein Coming-out sei allerdings kein erstrebenswertes gesellschaftliches Statussymbol, sondern oft eine schmerzhafte Selbsterkenntnis, die die Entwicklung von Selbstmitgefühl und schließlich Selbstakzeptanz benötige. Dann kann also dieser Schritt als Befreiung wahrgenommen werden. Der eigene Körper und die Orientierung sind weder gut noch schlecht. Sie sind einfach. Die Gefahren und Probleme beginnen bei den eigenen Reaktionen auf Deklassierungen des Umfelds. Es kann zu Kompensationsversuchen zum Beispiel in Form von zwanghaftem jugendlichen Aussehen, durch einen bestimmten Lifestyle oder etwa durch Missbrauch von Sexualität kommen. Diese Kompensationsversuche sind nichts weiter als Selbsttäuschungen: Auch wenn man die gewünschten Dinge bekommt, was nicht sichergestellt ist, sind auch sie dem Verfall unterworfen. Viele entwickeln Selbstbilder und Identitätskonstrukte, die nicht realistisch sind. Indem man an ihnen festhält, verengt sich das Selbstbild immer mehr. Erst daraus folgt Leid.
Ein mittlerer Weg
Wie kann also mit Identitäten umgegangen werden? Das Selbst und die eigene Identität sind nicht als Feind, als eine buddhistische Variante christlicher Erbsünde, zu sehen. Sie sind nicht das buddhistische Böse, das es zu bekämpfen und zu besiegen gilt. Buddhistische Praxis ist ein Weg zur Selbsterkenntnis, und die Lehre von Anatta kann ein Werkzeug für inneres Wachstum sein. Die Sicht, dass der Mensch kein unveränderliches Selbst besitzt, ist Voraussetzung für die Kultivierung einer heilsamen Haltung und die Überwindung von allem Unheilsamen.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung Special №. 1: „Buddhismus unter dem Regenbogen"
Ein mittlerer Weg vermeidet sowohl das Klammern an Identitäten wie deren Leugnung. Die Leugnung, dass jeder Mensch Identitäten besitzt, ist nicht nur ein Nihilismus, sondern übersieht gesellschaftliche Realitäten. Sie übersieht ebenso, dass ein Großteil der geistigen Formationen und Bewusstseinsinhalte Produkte von Gesellschaft und Kultur sind und somit auch problematisch sein können. Dies gilt es zu erkennen und weise damit umzugehen.
| Akāliko Bhikkhu, „Radical Rainbows: LGBTQIA+ Buddhist Pride and Inclusion“. |
| Butler, Judith. „Gender und andere Identitäten“, Philosophie Magazin, vol. Sonderausgabe 13 – 2019, Identität, Gender und gesellschaftlicher Wandel, 2019, S. 142–145 |
Tobias Trapp arbeitet als Software-Architekt und praktiziert richtungsübergreifend. Er ist einer der Gründer*innen der Sangha unter dem Regenbogen.
Bild Teaser & Header © Pixabay