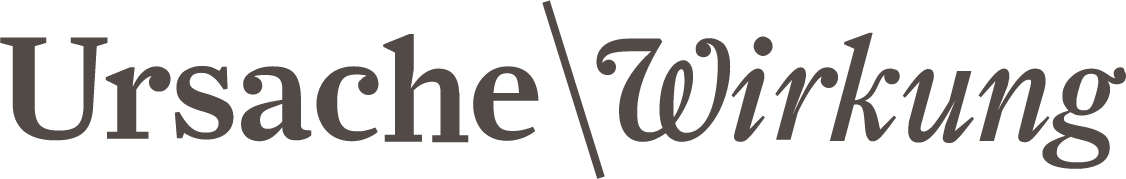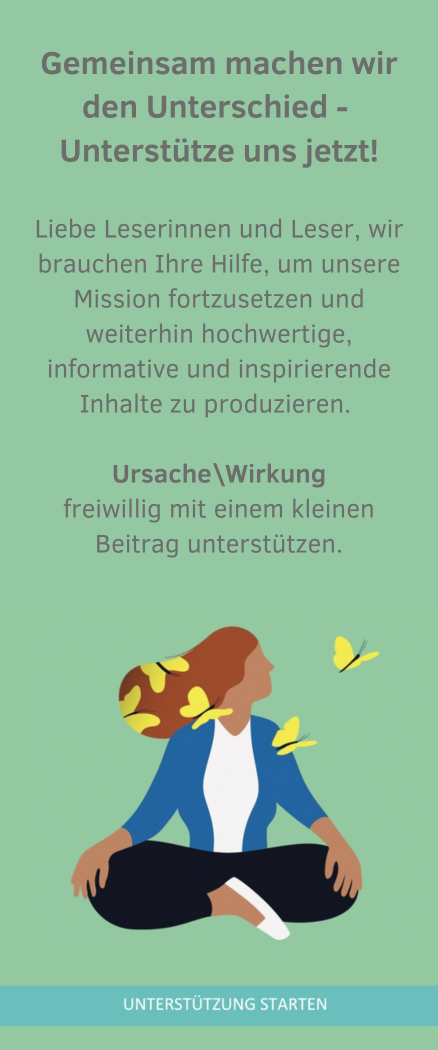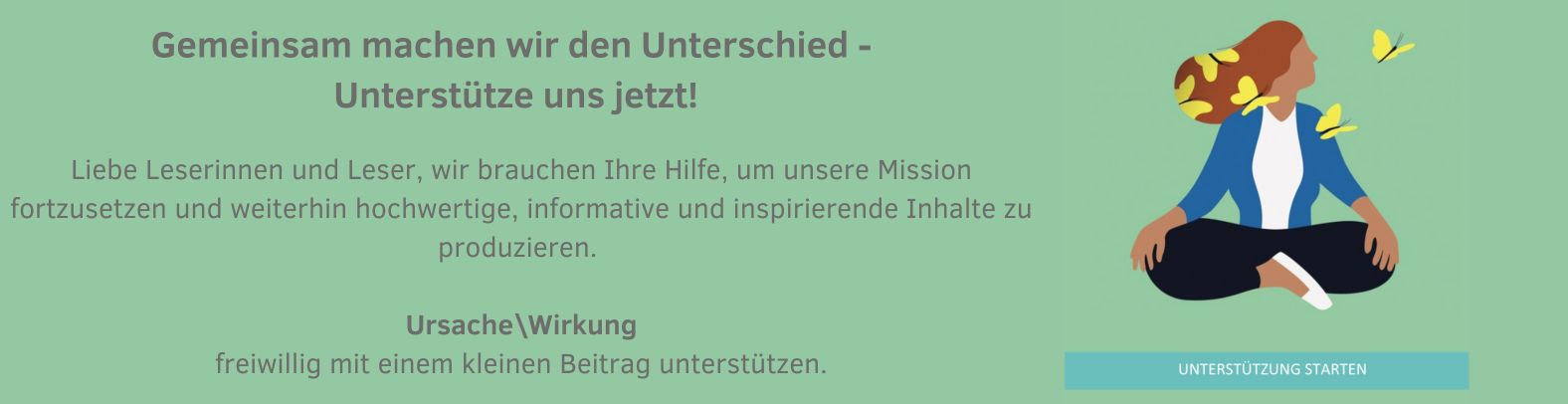Nach Ansicht von Philosophen, Psychologen, Soziologen und neuerdings auch von Neurowissenschaftlern ist die wichtigste Frage, die sich Menschen stellen, die nach dem ‚Wer bin ich?'. Sie wird in Wissenschaftskreisen auch Identitätsfrage genannt.
Übergebe ich die Frage dem globalen Wissenspool unserer Zeit, dem Internet, wird sie allein im deutschen Sprachraum über 3 Millionen Mal gestellt. Frage ich nur nach ‚Identity', bekomme ich ca. 180 Millionen Fundstellen. Einer der im Zuge dieser Recherche gefundenen Lebensberater erklärt: „Die eigene wahre Identität gefunden zu haben, ist die Grundvoraussetzung für Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und ein langes Leben."
Ein wissenschaftliches Buch über Identität beginnt mit der Feststellung: „Das Thema Identität dominiert seit einer Reihe von Jahren die öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatten so sehr, dass vom ‚Inflationsbegriff Nr. 1' die Rede war. Die Identitätsformel ‚Sich Erkennen, Erkannt- und Anerkanntwerden' ist zum Leitmotiv von Einzelnen und Gruppen, Minderheiten und Mehrheitsgesellschaft, Institutionen und Nationen, Wissenschaftsdisziplinen und Künsten geworden. Der politische Diskurs hat uns das Thema einer ‚nationalen Identität' und einer deutschen ‚Leitkultur' beschert, Firmen pflegen ihre ‚Corporate Identity', die Ratgeberliteratur empfiehlt uns ‚Identity Styling', in esoterischen Zirkeln begibt man sich auf die Reise zum ‚wahren Selbst'."
Wir halten die Frage nach der persönlichen Identität heute für natürlich und unumgänglich. Doch erscheint sie in der Kulturgeschichte des Abendlands erst im 8. Jh. v. Chr., in Homers Epos Odyssee. Odysseus ist es, der sie bei seinen Irrfahrten erstmals gegenüber Gastgebern in einer uns vertrauten Weise beantwortet. Und auch da schon mit dem nicht seltenen beträchtlichen Dünkel, der mit dem Wort ‚Ich' verbunden ist: „Ich bin Odysseus, Laertes' Sohn, durch mancherlei Klugheit unter den Menschen bekannt; mein Ruhm reicht bis in den Himmel." Davor hatte im westlichen Kulturraum noch niemand von sich als ‚Ich' gesprochen. Wie Kleinkinder heute noch, sprach man damals von sich nur in der dritten Person. Folglich gab es auch diese Frage nicht. Ähnlich war es bis ins 20. Jh. in vielen Sprachen außereuropäischer Völker.
Kurz nach Homer, zu Beginn der griechischen Philosophie, wird die Frage dort schon allgemein gestellt, und zwar verbunden mit einem religiösen und moralischen Auftrag. Jeder, der in den Apollotempel von Delphi eintritt, findet sich mit der Aufforderung konfrontiert: „Gnothi seauton", „Erkenne dich selbst". Es ist die wesentliche Frage, die jetzt jeder zu beantworten hat. Insbesondere Sokrates macht sie zu seiner Lebensaufgabe und zur Kernfrage der Philosophie. Mit ihr beginnt die Selbstreflexion, die Erkenntnis der Erkenntnis.
Doch schon vor den Griechen hatten sich die Brahmanen und Asketen Indiens der Selbsterkenntnis gewidmet und sie in den Upanishaden tiefgründig zu beantworten gesucht. Es war hier die Frage nach dem Atman. Sie persönlich zu beantworten, hieß ebenfalls, die entscheidende Lebensaufgabe zu lösen. Die Antwort, die gefunden wurde, prägte die indische Geistesgeschichte bis heute und hieß: „tat twam asi", „das bist du". Doch was bedeutet das, was ist mit dem ‚das' gemeint, das ich bin? Es ist das Atman, das Unsichtbare in allen Dingen, das als ewiges, unveränderliches Sein, als geistige Kernsubstanz allen Erscheinungen zugrunde liegt.
Von daher lag es nahe, dass auch der Buddha die Frage als zentrale Lebensfrage aufgriff. Er beantwortete sie jedoch in ganz anderer Weise, als sie sowohl in der indischen als auch in der griechischen Kultur üblicherweise beantwortet wurde. Unter den zahlreichen Aussagen, die vom Buddha überliefert sind, gibt es eine, in der er beschreibt, auf welche Weise viele Menschen seiner Zeit diese Frage stellen:
„Gab es mich in der Vergangenheit? Gab es mich nicht in der Vergangenheit? Was war ich in der Vergangenheit? Wie war ich in der Vergangenheit? Was war ich, und was bin ich daraufhin in der Vergangenheit geworden? Wird es mich in der Zukunft geben? Wird es mich in der Zukunft nicht geben? Was werde ich in der Zukunft sein? Wie werde ich in Zukunft sein? Was werde ich sein, und was werde ich daraufhin in der Zukunft werden? Oder ansonsten ist er über die Gegenwart verwirrt: Bin ich? Bin ich nicht? Was bin ich? Wie bin ich? Wo kam dieses Wesen her? Wo wird es hingehen?"
Buddha bemerkt dazu: „Wenn er [der Frager] auf solche Weise unweise betrachtet, entsteht eine von sechs Ansichten in ihm. Die Ansicht ‚für mich gibt es ein Selbst' entsteht in ihm als wahr und erwiesen; oder die Ansicht ‚für mich gibt es kein Selbst' entsteht in ihm als wahr und erwiesen (...) oder ansonsten hat er eine Ansicht wie diese: ‚Es ist dieses mein Selbst, das da spricht und fühlt und hier und da die Ergebnisse guter und schlechter Taten erfährt; dieses mein Selbst ist unvergänglich, dauerhaft, ewig, nicht der Unbeständigkeit unterworfen, und es wird so lange wie die Ewigkeit andauern.'"
Und dann heißt es: „Durch die Fessel der Ansichten gebunden, ist der unaufgeklärte Weltling nicht befreit von Geburt, Alter und Tod, von Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung; er ist nicht befreit von Dukkha (Leiden), sage ich."
2500 Jahre später sind die heutigen Fragen den damaligen erstaunlich ähnlich. Und die Antwort des Buddha steht immer noch im Gegensatz zu den Antworten, wie sie in den modernen westlichen Gesellschaften gesucht und gegeben werden. So verspricht uns der obige Lebensberater, dass wir ‚Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und ein langes Leben erlangen', hätten wir die eigene Identität gefunden, während der Buddha uns ankündigt, dass wir im Gegenteil damit Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung – kurz dukkha – ernten würden.
Könnte nicht die Tatsache, dass wir uns heute die Frage „Wer bin ich?" so oft und intensiv stellen und zugleich in unserer fortschrittlichen, reichen westlichen Welt im Allgemeinen so viele Selbstzweifel und -ängste haben und weiter von Zufriedenheit, Glück und Gesundheit entfernt sind, denn je, vielleicht darauf hinweisen, dass nicht unsere Philosophen, Psychologen, Lebensberater und Esoteriker, sondern der alte Buddha näher an der Wahrheit des Lebens und Leidens war?
Hierzu nur ein Beispiel. Gerade an dem Tag, an dem ich die Einladung zu diesem Beitrag für U&W bekam, erhielt ich ein neu erschienenes Buch, das ebenfalls von einem Inder stammt, von Amartya Sen, einem Ökonomen, Sozialwissenschaftler und Nobelpreisträger unserer Tage. Der Titel lautet: ‚Die Identitätsfalle – Warum es keinen Kampf der Kulturen gibt'. Ebenfalls am selben Tag las ich in einer großen deutschsprachigen Tageszeitung einen Bericht über die rapide Zunahme von brutalen Ehrenmorden an jungen Liebespaaren im derzeitigen Indien durch die eigenen Verwandten – ein Phänomen, das ja auch bei uns zu hitzigen Diskussionen geführt hat.
Der konkrete Hintergrund dieser Ehrenmorde ist, dass sich im heutigen Indien unter dem Einfluss der globalisierten Industrie- und Konsumgesellschaft die alten Kastenschranken einerseits zwar auflösen, doch andererseits von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung aus Angst vor dem Verlust traditioneller Ordnung, Sicherheiten und Privilegien mit zunehmender Gewalt verteidigt werden.
Der sogenannte Kampf der Kulturen, der Terrorismus, die Banken- und Finanzkrise, die Ehrenmorde: Alles hat mit derselben Problematik zu tun – mit den verhängnisvollen Auswirkungen des Festhaltens an jeweiligen Identitäten. Amartya Sen sagt, es sind die Folgen fixer Identitätszuschreibungen in Bezug auf sich selbst und die anderen, auf den Einzelnen, die Gruppe, die Sippe, das Volk, die Nation, die Rasse, die Klasse, die Kaste, den Besitz, die Religion, die Kultur, das Geschlecht und mehr. Amartya Sens Forderung für unsere Zeit lautet, dass wir uns endlich vom Identitätsdenken befreien müssen.
Genau das hat der Buddha bereits vor 2500 Jahren erkannt. Seine Kritik des Ich-Konzepts, seine Zurückweisung der brahmanischen Atman-Idee eines ewigen, unveränderlichen Selbst in allem und jedem, seine ‚Ohne-Ich-Lehre' hat ihren Hintergrund in den in Indien damals schon offenkundig leidvollen, individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen des ‚Ich-und-Mein-Denkens'. Wenn der Buddha dagegen die Erkenntnis der Unbeständigkeit (anicca) aller Erscheinungen setzt, des Ungenügens (dukkha), der Nichtsubstantialität (anattā), der Leerheit (sunyata), des Nicht-Anhaftens, des Loslassens, der Befreiung, dann kann all das von diesem realen Hintergrund her verstanden werden.
Und da sich an dem menschlichen Durst (tanhā) des Ergreifens, Festhaltens, Identifizierens, des Sein-, Haben- und Besitzen-Wollens (upādāna) bis heute nichts geändert hat – im Gegenteil das Verhalten und die Verhältnisse noch krasser und globaler geworden sind –, darum ist der Buddha heute auch so enorm aktuell, was viele Menschen intuitiv erkennen. Buddhas Einsicht war also in keiner Weise weltfremd, weltflüchtig, esoterisch, nur aufs Jenseitige und Transzendente gerichtet. Sie war ganz diesseitig konkret und mit praktischen Folgen.
Die moderne Frage nach dem Ich oder Subjekt beginnt mit der Neuzeit und der modernen Philosophie. Dazu heißt es unter anderem bei Wikipedia: „Ich ist die Bezeichnung für die eigene separate individuelle Identität einer menschlichen natürlichen Person, zurückweisend auf das Selbst des Aussagenden. Beispiel: ‚Ich denke, also bin ich' von René Descartes: cogito ergo sum."
Das heißt doch nun, dass in dieser Ich-Suche das bereits vorausgesetzt wird, was eigentlich erst gefunden werden soll, nämlich das Ich. Wenn das Denken davon ausgeht, dass es das Ich ist, das denkt, dann kann das Denken auch nur ein Ich finden, das denkt. Dieser in der abendländischen wie indischen Philosophie zu findende, vielfach gerühmte Satz ist schlichte Selbsttäuschung, eine Tautologie, eine zirkuläre Aussage. Er fragt überhaupt nicht, sondern weiß schon. Auf diese Weise kann die Frage „Wer bin ich?" nie sinnvoll beantwortet werden.
Der Buddha hatte auch das 2000 Jahre vor Descartes bereits durchschaut: Das sogenannte Ich (identifiziert mit dem Subjekt) kann nicht sagen, wer oder was es ist, denn dies entspräche der Forderung, dass sich das Auge selber sehen soll. Nur ein Bewusstseinsprozess, der sich nicht einseitig mit dem Betrachter (Subjekt) oder dem Betrachteten (Objekt) identifiziert, eine Bewusstheit ohne Ich, kann sich selbst erkennen. Diese Art von Bewusstsein beginnt mit der Praxis der Achtsamkeit (sati) und führt auf dem Weg langer Einübung und Umwandlung zur Erkenntnis des Erwachens (bodhi). Hier erscheint eine Weisheit, die nicht mehr zwischen sich und anderem oder anderen trennt, die nirgendwo anhaftet, sich mit nichts identifiziert, nichts abwehrt oder ausschließt, sich zugleich mit allem verbunden weiß, die leer oder offen ist.
Aber was ist dann das, was als ‚Ich bin das' erlebt wird? Das hat der Buddha in der Lehre vom paticca samuppada, dem Prozess des ‚wechselseitig bedingten Entstehens' der Erscheinungen, eingehend beschrieben. Sie heißt: Ich bin dieser Augenblick, dieser Moment der Wahrnehmung – des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens, Tastens –, des Denkens, Fühlens, Sprechens und Tuns. Was als dauerhaftes und eigenständiges Ich erscheint, ist nur dieser gegenwärtige Augenblick. Der ist allerdings geprägt, ja stark konditioniert von dem, was in der Vergangenheit wahrgenommen, gedacht, gefühlt, gesprochen und getan wurde. Und ebenso von dem, was (als Absicht) in der Zukunft wahrgenommen, gedacht, gefühlt, gesprochen, getan werden soll. So kommen in diesem Augenblick alle Aspekte des Daseins in allen drei Zeiten zusammen und erzeugen gedanklich das, was als ‚Ich' erfahren wird. Dieses Ich ist nicht mehr als ein Konzept, eine Idee, eine Vorstellung. Die wirkliche Gegenwart, das Gewahrsein des Augenblicks, ist nicht beschreibbar, nicht benennbar, nicht ergreifbar – nur erfahrbar.
In gleicher Weise gibt dieser Beitrag zur Frage „Wer bin ich?" hoffentlich einige hilfreiche Hinweise, doch keine persönliche Antwort. Das kann er auch gar nicht und kann niemand. Die Antwort auf die Frage „Wer bin ich?" kann nur von jedem unmittelbar erfahren und gelebt werden – in dem Maße, in dem er oder sie sich auf die direkte Erfahrung der Gegenwart einlässt. Sie ist in jedem Augenblick anders, neu, einzigartig, nicht identisch und in keiner Weise fassbar.