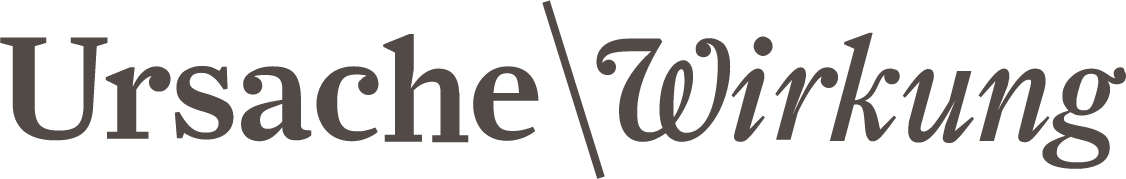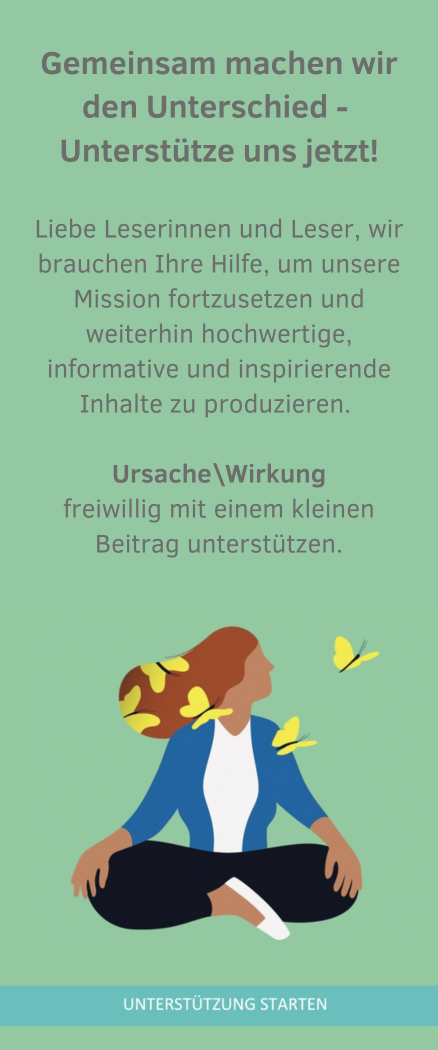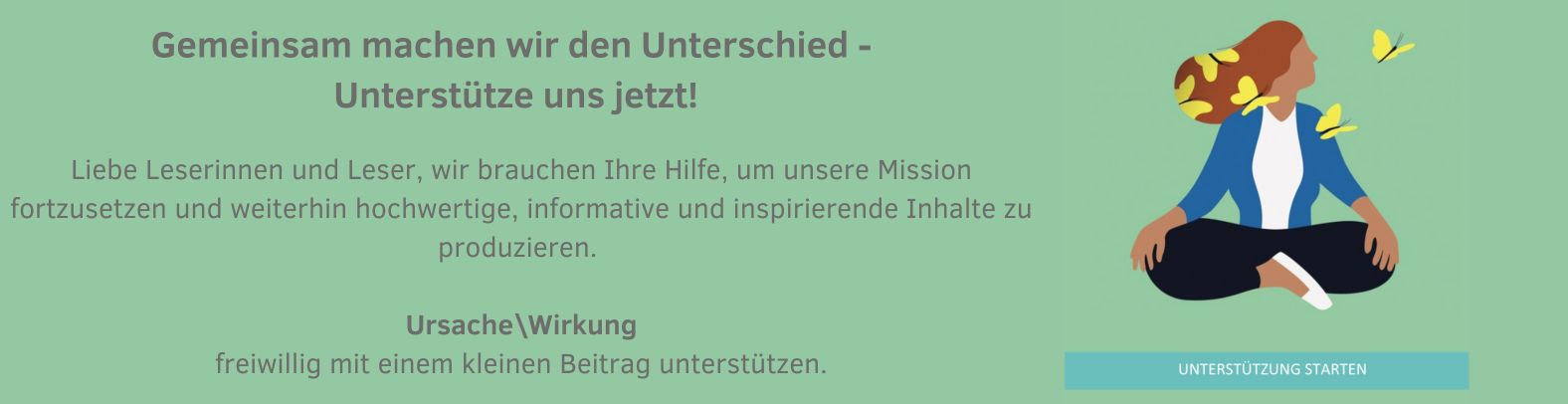Theologe und Zen-Lehrer Michael von Brück über eine der wichtigsten Fragen der Menschheit.
Vorbemerkung
Was denn original an seiner Person sei, beschäftigte nicht nur Goethe, der bekanntlich resümierte, ‚vom Mütterchen die Frohnatur' und vom ‚Vater die Statur', mehr noch, die Fähigkeit zum ‚Ernst des Lebens' ererbt zu haben. Wir sind das Resultat unserer Biografie, namentlich der frühkindlichen Prägungen. Alles, was wir erinnern, haben wir erfahren, erlernt, von anderen vermittelt bekommen. Nun vermeldet die Hirnforschung, dass selbst die Formen und Modi, nach denen wir Erinnerungen speichern, nicht einfach ererbt sind, sondern in der frühen Kindheit angelegt werden: Die ‚Architektur' des Gehirns schafft sich selbst, natürlich in einem Rahmen, der biologisch vorgegeben ist, mithin anthropologische Universalia nachzeichnet. Aber die kulturellen und individuellen Spezifika sind Einflüsse, denen wir unterworfen sind. Wo bleibt da ein Ich?

Ein allgemeines Urteil, das in den Kulturwissenschaften ebenso wie in der Philosophie gängig ist, lautet: Der ‚Westen' habe das autonome Ich entdeckt (und dann, mit Sigmund Freud, relativiert), der ‚Osten' hingegen pflege den Blick auf das Nicht-Ich – besonders im Buddhismus und Taoismus.
Dass dieser Schematismus falsch ist, kann die Vergleichende Religionswissenschaft ohne Schwierigkeit belegen. In den indischen Traditionen etwa zeigt sich ein differenziertes Bild. Die Unterscheidungen von jiva (individuelles Lebensprinzip), ahamkàra (Ich), àtman (der transzendente Grund der Person), purusha (die geistige, transhistorische Geistigkeit) usw. zeigen, wie differenziert die Analyse ist. Zwischen den einzelnen philosophischen Systemen gibt es zudem erhebliche Unterschiede.
Im ‚Westen', also in der griechischen Philosophie, den christlichen Theologien und der neuzeitlichen Philosophie, wird deutlich zwischen ‚Ich' und ‚Person' unterschieden. ‚Ich' ist das Abgegrenzte, ‚Person' das Relationale, wie z.B. die Philosophie des Neuplatonismus, die die christliche Theologie nachhaltig geprägt hat (Trinitätslehre), nicht müde wird zu betonen. Augustinus wollte in seiner Trinitätslehre (De trinitate) statt persona lieber relatio sagen, nahm aber davon Abstand, weil der Begriff zu abstrakt sei. Jedenfalls ist das, was heute unter dem Stichwort des ‚Transpersonalen' verhandelt wird, eine Wiederaufnahme der jahrhundertelangen Debatten um den Personbegriff: Person als das, was sich nicht selbst verdankt, was nicht abgegrenzt ist, was in Relationen (aller Dimensionen) seine aus dem Transzendenten kommende Identität gewinnt.
Die heutige philosophische (und psychologische) Debatte dreht sich weniger um Identitätsphilosophie oder Fragen der Unterscheidung von Ich und Person, sondern aufgrund der revolutionären Entwicklungen in den Neurowissenschaften um eine naturwissenschaftliche Untermauerung kognitionstheoretischer Modelle. Dabei geht es letztlich, in veränderter Gestalt, erneut um das Leib-Seele-Problem, das aber als solches reduktionistisch ausgeklammert wird, denn keine der etablierten Wissenschaften befasst sich ernsthaft mit dem Leib-Seele-Problem. Die Philosophie nicht mehr, und die Religionswissenschaft bzw. Theologie nur auf historischer Basis, die Psychologie hingegen versteht sich als Wissen von (objektivierbarem) Verhalten, nicht vom bewussten Erleben aus der Perspektive der 1. Person. Wenn wir also das, worum es der Bewegung der Transpersonalen Psychologie geht, genauer bestimmen wollen, müssen wir fragen, was Bewusstsein ist.
Bewusstsein ist, wie Descartes richtig feststellte, das einzig Gewisse, was wir haben, aber es kann durch den Riss eines feinen Äderchens oder durch ein Toxin in Sekundenbruchteilen außer Gefecht gesetzt werden. Schon William James bemerkte, dass Bewusstsein kein ‚Ding' sei, das man irgendwo lokalisieren könne, sondern vielmehr ein Prozess, dessen Dynamik man studieren könne. Wir wissen heute, dass Bewusstsein der Prozess des ständigen Entstehens und Vergehens von Bewusstseinszuständen ist, derer es mehrere Milliarden geben muss. Man hat gemessen, dass ein hinreichend konstanter Bewusstseinszustand ca. 150 Millisekunden andauert, dann verändert sich die neurologische Basis dieses Zustandes, was man durch bildgebende Verfahren in der Hirnforschung (Computertomographie usw.) zeigen kann.
Ich zitiere den Physiker, Molekularbiologen und Neurowissenschaftler Alfred Gierer, der die Fragestellung prägnant so erfasst:
„Dem Menschen ist sein eigener Zustand im Bewusstsein unmittelbar gegeben, etwa in Form von Gefühlen, Erinnerungen, Absichten, Gedanken, Ängsten. Was ist Bewusstsein? Sicher eine Eigenschaft des Gehirns; also auch ein Ergebnis von Prozessen im Nervennetz. Erklärt dies aber, warum wir einen unmittelbaren Zugang zu unserem inneren, ‚seelischen' Zustand haben, oft ohne Vermittlung der Sinne, ohne Regel, ohne Kenntnis der elektro-physiologischen Vorgänge im Nervensystem? Ist bewusstes Erleben ‚nichts als' ein Aspekt physikalischer Prozesse im Gehirn, ist die Freiheit unseres Denkens und Wollens eine Illusion? Wie verhalten sich physikalische Gehirnprozesse zu logischem Denken, wie weit kann man das menschliche Gehirn mit einem Computer vergleichen? Wie wirklich sind Ideen? Ist Gefühl wissenschaftlich erklärbar, wie können wir etwas von den Gefühlen anderer wissen...? Eine lange Liste von Grundfragen des menschlichen Selbstverständnisses berührt das vielleicht größte und tiefste Problem im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, den ‚Weltknoten', wie Schopenhauer es genannt hat – die Beziehung zwischen ‚Leib' und ‚Seele'; 2500 Jahre Geschichte der Philosophie, und doch keine Lösung."
In westlichen Kulturen ist eine Tendenz erkennbar, das Ich als eine mehr oder weniger autonome Instanz zu empfinden, die alle Eindrücke sammelt, verknüpft und nach eigenen Willensentscheidungen ordnet und Reaktionen entwickelt. Das Ich stünde damit auf einer höheren Hierarchieebene als die Verarbeitungssysteme für Wahrnehmungen von Objekten. Das Ich wäre dann eine Zentrale, die alles steuert, und hätte einen Ort im Hirn, nach dem nicht nur Descartes (vergeblich) gesucht hat. Anders im Buddhismus: Hier glaubt man nicht an die Existenz eines unabhängigen Ich, sondern vermutet, dass das Ich eine Einbildung sei, die zustande kommt, wenn Bewusstseinsvorgänge sich selbst aktiv koordinieren. Das, was ist, sind einzelne Verknüpfungsvorgänge, aber die Zentrale existiert nicht, der Ego-Zentrismus ist vielmehr das, was durch spirituelle Einsicht überwunden werden müsse. Dies ist nun eine interessante These, weil sie genau dem zu entsprechen scheint, was Hirnforschung heute als Ergebnis des Wissens bezeichnet: Eine zentrale Ich-Funktion ist neurobiologisch nicht auffindbar (und zur Erklärung nicht nötig), das Ich erscheint als kulturell abhängige biografische Konstruktion. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich das Gehirn prinzipiell von einem Computer: Anders als beim Computer sind beim Gehirn Hard- und Software nicht zu trennen (das Gehirn erzeugt Sprache, aufgrund von Sprache erst können dann aber im Gehirn neue Vernetzungsstrukturen angelegt werden). Der Computer arbeitet mit einer zentralen Schalteinheit, dem Prozessor, und einem festgelegten binären Code. Das Gehirn hat keine solche Zentrale und keinen eindeutigen Code, was ihm die enorme Variabilität und Flexibilität verleiht, die der Computer prinzipiell nicht haben kann: Dieser könnte zwar quantitativ immer mehr Schaltkreise haben, hat aber nicht die strukturelle Flexibilität der multiplen Verknüpfungsmöglichkeiten des Gehirns, und es gilt: Nicht Logik, sondern Selektion ist die Arbeitsweise des Gehirns, also nicht binäre Entscheidungen, sondern Mustererkennung und Denken in Metaphern. Infolgedessen werden neuronal die Signale nicht eindeutig verarbeitet, sondern in komplexen Selektionsprozessen gruppiert, kartiert und begrifflich zusammengehörig verarbeitet. Dabei sind einzelne Neuronen und Neuronengruppen z.B. im Sehfeld für verschiedene Aufgaben einsetzbar, in je unterschiedlicher Kombination. Die einmal gewählte Zuordnung ist ein Bewusstseinszustand, der nicht gleichzeitig mit anderen ablaufen kann, sondern man muss die Zuordnungen bzw. die Perspektiven bzw. die Bewusstseinszustände wechseln, um das jeweils andere Gruppierungsmuster zu sehen.
Buddhistische Meditation ist Versenkung (samādhi) des Bewusstseins, was bedeutet, dass die oberflächlichen disparaten und einander widerstrebenden Bewusstseinsbewegungen zu einem ruhigen Strom des Bewusstseins vereinheitlicht werden.
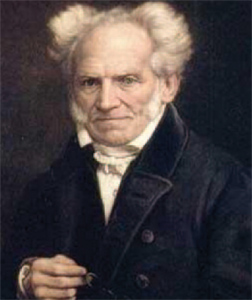
Die notwendigen Voraussetzungen betreffen einerseits die physische Gesundheit, die durch Mäßigung erreicht werden soll, sowie andererseits die rechte Motivation zur Praxis, die durch das Hören und Memorieren der Lehren des Buddha entstehen soll. Die Motivation zur Ausdauer in der Übung entwickelt sich einerseits vor allem durch die Analyse der Vergänglichkeit und Leidhaftigkeit des Daseins, andererseits durch die Erkenntnis, dass die Wiedergeburt als Mensch selten und kostbar ist und darum keine Zeit vertan werden darf. Angesichts der Grundeinsicht in die gegenseitige Abhängigkeit aller Erscheinungen gibt es daher neben der analytischen Meditation eine synthetische Bewusstseinsschulung, bei der beispielsweise positive Gedanken und Empfindungen zunächst zu den Freunden, dann zu entfernteren Wesen, schließlich zu den Gegnern und dann in das ganze unermessliche Universum (die ‚Vier Unermesslichkeiten') ausgestrahlt werden sollen.
Die Praxis der Meditationsübung hat in der Geschichte des Buddhismus, vor allem in Zentral- und Ostasien, erhebliche Veränderungen erfahren. Die frühbuddhistische Meditation ist im Wesentlichen eine Achtsamkeits-Meditation (satipaṭṭhāna) gewesen und die damit verbundenen Übungen sind, leicht abgewandelt und ergänzt, die Grundlage für alle Meditationssysteme im Buddhismus geblieben. So verschieden im Einzelnen die Meditationstechniken sich auch entwickelt haben, Achtsamkeit ist und bleibt die wesentliche Übung. Verschiedene allgemeine Übungen sollten zur Kultivierung des Geistes in diesem Sinne führen, so etwa
- die Beobachtung des Atemflusses,
- das Zählen des Atems,
- die Betrachtung der Unreinheiten des Leibes (bis hin zu Visualisationen von Leichen).
Darüber hinaus werden die sogenannten vier Bereiche der Achtsamkeit unterschieden, die in ihrer Gesamtheit die vollkommene Achtsamkeit in Bezug auf alle psycho-physischen Vorgänge ermöglichen:
- Achtsamkeit des Körpers (kāya), nämlich die Vergegenwärtigung, dass der Leib unrein ist,
- Achtsamkeit der Empfindungen (vedanā), nämlich die Vergegenwärtigung, dass diese leidvoll bzw. die mit Empfindungen verbundenen Erwartungen frustrierend sind,
- Achtsamkeit des Bewusstseins (citta), nämlich die Vergegenwärtigung, dass dieses fluktuierend ist,
- Achtsamkeit der äußeren Objekte (dharma), nämlich die Vergegenwärtigung, dass diese ohne substanzielle Realität und vergänglich sind.
Wir wollen die Ausführungen zu diesem zentralen Thema des Buddhismus zusammenfassen: Achtsamkeit (Pàli satipaññhàna) ist im Buddhismus eine Art und Weise des konzentrierten Bewusstseins, in der es sich selbst und alle Außeneindrücke wahrnimmt. Achtsamkeit ist reines Beobachten oder Gewahrsein, ohne dass mentale oder kognitive Projektionen die Wahrnehmung und die mentale Wahrnehmungsverarbeitung trüben würden. Die normale Aufmerksamkeit des Menschen ist eher diffus. Diese diffuse Präsenz bündelt sich in achtsamer Wahrnehmung, wenn ein Objekt erscheint, registriert und dann begrifflich gedeutet wird. Achtsamkeit ist damit der Kern jeder Wahrnehmungstheorie, jeder Ästhetik. Und da alles, was für den Menschen geschieht, im Bewusstsein repräsentiert bzw. konstruiert wird, ist Achtsamkeit die Pforte des Menschen zu sich selbst und zur Welt. Achtsamkeit erweist sich damit als objektzentriert. Sie ist eine wichtige Voraussetzung der meditativen Versenkung, aber gerade so ist sie nicht identisch mit Versenkung (samàdhi). Denn diese hat letztlich kein Objekt, sie ist ein unbegrenzter Raum von Bewusstheit, der nicht näher beschrieben werden kann, weil jede Beschreibung Definition bzw. Abgrenzung bedeuten würde, während – jedenfalls in tieferen Versenkungsstufen – eine ‚Raumunendlichkeit' (wie es im frühen Buddhismus heißt) erzielt wird, die das Bewusstsein an nichts anhaften lässt.
Die buddhistische Wahrnehmungstheorie geht davon aus, dass alles Wahrnehmen im Bewusstsein vorgebildet wird. Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken, die im Augenblick erscheinen, sind geprägt von früheren Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken sowie von gegenwärtigen Eindrücken. Gegenwärtige Eindrücke werden nach Mustern verarbeitet, die im Verlaufe der Lebensgeschichte angelegt worden sind. Nichts wird wahrgenommen, ‚wie es ist', sondern eingefärbt durch den Charakter, den das Bewusstsein bereits ausgebildet hat und durch den alles ‚gefiltert' wird. Diesen Filter genau kennenzulernen, zu verstehen und zu ‚reinigen', ist eine unabdingbare analytische Aufgabe, die mit Achtsamkeit vollzogen werden muss.
Das, was wir denken, ist also nicht eine eindeutige Repräsentation der Welt, sondern Resultat des Zusammentreffens von ‚Welt' und unseren historisch erlernten, aus der evolutiven Selektion hervorgegangenen Erfahrungsmustern, wobei zur ‚Welt', die diesen Mustern begegnet, auch die eigene innere Erfahrung gehört. Das Gehirn gleicht zwischen diesen Reizen ständig ab und verarbeitet sie nach den sich ständig neu konstellierenden Verschaltungsmustern. Einfach gesagt: Wir erfahren das, was uns das Gehirn erfahren lässt. Und das ist historisch bedingt und vieldeutig. Daraus folgt, dass Bewusstseinszustände abhängig sind von der Biografie, der Übung, d.h. erlerntem Gebrauch.
Die Gesamtwahrnehmung steht häufig, zumindest tendenziell, vor einer selektierenden Bewertung. Solche Bewertungen basieren, wie die Hirnforschung zeigt, auf nicht bewussten Abläufen in den Basalganglien, dem Kleinhirn usw. Es wäre also möglich, dass in tiefen meditativen Versenkungen die entsprechenden Bewertungssignale unterbunden oder modifiziert werden, d.h. das gesamte Gehirn ist im Zustand mystischer Versenkung einfach anders konfiguriert als im Wachbewusstsein, im REM-Schlaf oder im Tiefschlaf. Es erscheint vielmehr ein Selbstbewusstsein, das sich selbst spiegelt, sich also nochmals auf einer weiteren Komplexitätsebene mit allem anderen in Beziehung setzt, und es spiegelt sich in jeder gerade wahrgenommenen Einzelheit, das macht die Komplexität aus. Selbstbewusstsein wird in der Hirnforschung als Metarepräsentation von verknüpften Repräsentationen begriffen, die das Hirn selbst generiert. Das Selbst dieses Selbstbewusstseins ist aber nicht beschränkt auf das individuierte Ich, sondern es ist das Selbst des gesamten Wahrnehmungshorizonts, jenseits der Differenzierung von Ich und Anderem bzw. der Zeitmodi (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft), wenngleich diese Differenzierungen systemisch enthalten sind. Anders als die Vermutung Sigmund Freuds, nach der ‚ozeanische Gefühle' eine Ich-Auflösung und Entgrenzung bedeuten, die destruktiv ist, sind meditative Versenkungen etwas ganz anderes: nicht Ich-Auflösung im Unendlichen, sondern Ich-Integration im Ganzen. Es handelt sich dabei um eine Aufmerksamkeit, die nicht das Hintergrundrauschen der komplexen Eindrücke unterdrückt (wie bei der normalen Aufmerksamkeit auf ein Objekt), sondern eine Aufmerksamkeit, die subtil alles vereint. Bewusstseinszustände, so sahen wir oben, sind abhängig von der Biografie, der Übung usw. Die verschiedenen meditativen Übungen eröffnen eine weitere Gruppe von Zuständen, die integriert sind, wobei die subtile und kognitive Information, wie wir an den Texten sahen, keineswegs verloren geht. Meditation maximiert diese Information vielmehr für eine Gesamtwahrnehmung, denn sie ermöglicht eine äußerst feine, subtile Wahrnehmung des Einen als Zusammenhang. Meditation ermöglicht ein Maximum an Komplexität und Integration. Wenn dies als Merkmal von Bewusstsein gesehen wird, eröffnet Meditation eine Maximierung von Bewusstsein. Ein unveränderliches Ich spielt dabei keine Rolle.